Der Tag hat noch gar nicht richtig angefangen, da haben wir schon tausend Dinge im Kopf: schnell anziehen, frühstücken, zur Arbeit hetzen … Kaum dort angekommen, füllt sich der Schreibtisch schneller als ein Fußballstadion beim Finale der Weltmeisterschaft. Der Kopierer streikt, das Meeting wurde vorverlegt und der Kaffee ist alle. Nach nur zwei Stunden Arbeit ist man direkt wieder reif für das Bett, weil man letzte Nacht schon wieder kaum geschlafen hat.
Ein Beitrag von Dr. Madlen Ziege
Und wer hat Schuld an der Misere? Für viele ist es der Stress selbst. Stress ist der Sündenbock unserer Zeit. Er macht uns krank, kaputt und kraftlos. Hinterlistig lauert er uns nicht nur auf der Arbeit auf. Auch in der Freizeit macht er sich breit und lässt uns hastig von einem Termin zum nächsten springen. Kein Wunder, dass uns überall Produkte angeboten werden, die versprechen, den Stress loszuwerden oder ihn wenigstens zu reduzieren. Mit Yoga, Wellness oder Powerfood sagen wir dem Stress den Kampf an! Doch ist Stress wirklich so schlecht wie sein Ruf? Oder tun wir dem Stress unrecht, indem wir ihn für unsere eigene ungesunde Lebensführung verantwortlich machen?
Ist Stress wirklich der Übeltäter?
Diese Frage stellte ich mir, als ich in Frankfurt am Main zum Thema Stadtökologie promovierte. Ich wollte unter anderem wissen, ob Stadtkaninchen weniger Stress haben als ihre Artgenossen auf dem Land. Dazu musste ich aber erst mal wissen, was „Stress“ überhaupt bedeutet und wie ich ihn messen kann. Und da fing der Stress für mich erst richtig an …
Wie Asterix und Obelix auf der Suche nach dem Passierschein A38 irrte ich von einem Fachbuch über Stress zum nächsten. Auf dem Weg begegneten mir viele Mythen, Märchen und Missverständnisse rund um das Thema. Allein schon die Bedeutung des Wortes ist nicht ganz klar. Für die einen ist Stress alles, was von außen auf uns einbricht und unser Gleichgewicht durcheinanderbringt, für die anderen kommt Stress aus uns selbst heraus. Wir selbst entscheiden bewusst oder unbewusst, ob uns etwas stresst oder nicht.

So entstand das Konzept von Stress
Dieses Bedeutungs-Wirrwarr hat seinen Ursprung bei dem Vater des Stresses: Hans Hugo Selye. Der entdeckte in den 1940er-Jahren in seinem Labor in Montréal zufällig den Stress. Eigentlich war der Mediziner auf der Suche nach einem bisher unbekannten Hormon. Dazu spritzte er
Ratten eine Lösung, die er zuvor aus den Eierstöcken von Kühen herstellte. Die Ratten reagierten darauf mit geschwollenen Lymphknoten, blutenden Eingeweiden und vergrößerter Nebennierenrinde. Für Selye war diese Reaktion seiner Laborratten ein eindeutiger Hinweis darauf, dass er sein Ziel erreicht hatte. Die Wissenschaft wusste damals schon, dass die Lymphknoten bei der Reaktion auf Hormone beteiligt sind.
Warum sich auch die Eingeweide auflösten und die Nebenniere verrücktspielte, konnte sich Selye allerdings nicht erklären. Er forschte weiter und stellte zu seiner Überraschung fest, dass die Ratten die gleiche Reaktion zeigten, wenn er ihnen andere chemische Stoffe gab, beispielsweise Formalin. Und auch auf Kälte, Hitze oder körperliche Überanstrengungen zeigten die Ratten immer die gleichen Reaktionen: geschwollene Lymphknoten, blutende Eingeweide und vergrößerte Nebennierenrinde. Selye wusste nun, dass er hier etwas viel Größerem auf der Spur war als nur der Erforschung eines neuen Hormons. Er taufte seine Entdeckung „Allgemeines Anpassungssyndrom“, das später den Namen „Stress“ bekommen sollte.
Das Missverständnis um Stress
Für Selye war klar, dass der Stress der Ratten eine Reaktion auf die Anforderungen von außen war. Die blutenden Eingeweide, die geschwollenen Lymphknoten und die vergrößerte Nebennierenrinde waren alles Anzeichen dafür, dass der Körper gegen den Kuh-Cocktail kämpfte. Wie ein Sondereinsatzkommando greift Stress ein, wenn das Fußballspiel außer Kontrolle gerät. Stress war somit aus Selyes Sicht etwas Gutes, denn er hilft dem Körper, trotz Einflüssen von außen im Gleichgewicht zu bleiben. Der eigentliche Übeltäter ist somit nicht der Stress, sondern es sind die Anforderungen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Sind diese zu groß, kann der Körper so viel reagieren, wie er will – er wird nicht mehr zurück ins Gleichgewicht kommen. Aber wieso haben wir von Stress heute so ein schlechtes Bild, wenn sein Entdecker doch so positiv über Stress sprach? Im Laufe der Zeit wurden Stress immer wieder neue Bedeutungen zugesprochen. Die Aussprache von Herrn Selye, der gebürtiger Wiener war, tat dabei sein Übriges. Selye sprach ursprünglich von Stress als das, was von außen auf die Ratten einwirkte: das Kuh-Gemisch, das Formalin oder die Hitze. Die Reaktion der Ratten nannte er „Strain“, englisch für Widerstand. Stress und Strain klangen jedoch sehr ähnlich, wenn Selye sie mit seinem schlechten Englisch aussprach. Nach dem Stille-Post-Prinzip wusste nach zahlreichen Vorträgen von Selye niemand mehr, was nun eigentlich der Stress und was der Strain war. Stress kam gleichzeitig von außen und von innen. Stress war sowohl das giftige Formalin als auch die blutenden Eingeweide. Sätze wie „Stress bringt mich noch um“ oder „Von dem ganzen Stress bekomme ich noch Magengeschwüre“ verdanken wir also der Reaktion der Laborratten von Herrn Selye. Klar, dass seither keiner etwas mit Stress zu tun haben will.
Stress aus Sicht der Natur
Auch ich machte während meiner Promotion Stress dafür verantwortlich, dass mir die Haare ausgingen, ich Schlafstörungen und einen Nervenzusammenbruch hatte. Bis ich eines Tages damit begann, Stress aus Sicht der Evolutionsbiologie zu betrachten: Stress ist, wenn die Fitness sinkt! Und mit Fitness meine ich nicht, dass ein Kaninchen besonders hoch springen oder eine Biene schnell fliegen kann. Ich meine die biologische Fitness, die Anzahl eigener Nachkommen und die enger Verwandter. Es geht darum, möglichst lange zu leben und sich möglichst viel fortzupflanzen. Und das geht nur, wenn sich Tiere, Pflanzen, aber auch Pilze und Bakterien immer wieder neu an ihren Lebensraum anpassen.
Die biologische Fitness können wir uns vorstellen wie ein Bankkonto. Alles, was zu einem langen Leben und vielen eigenen Nachkommen und Nachkommen enger Verwandter beiträgt, zahlt auf dieses Konto ein. Gleichzeitig gibt es die Stressfaktoren, die es der Fitness schwer machen: Fressfeinde, Parasiten oder höhere Temperaturen – theoretisch kann alles im Leben zu einem Stressfaktor werden. Diese Stressfaktoren „buchen“ vom Fitnesskonto ab. Die Folge: Die Fitness geht runter und der Stress geht rauf.
Und genau dieser Zusammenhang war es auch, der erklärte, warum es immer mehr Wildkaninchen in der Stadt und immer weniger auf dem Land gibt. Im ländlichen Umland finden Wildkaninchen kaum noch genug Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Riesige offene Agrar- und Grasflächen bieten keine dichten Böschungen für die Anlage von Kaninchenbauten. Doch diese Bauten sind wichtig, damit die Wildkaninchen ihre Jungen geschützt aufziehen und sich selbst vor Feinden in Sicherheit bringen können. Gleichzeitig gibt es vor allem
im Winter nicht genug Nahrung, damit alle Kaninchen überleben könnten. Um die Fitness der Landkaninchen ist es somit nicht gut bestellt. In der Stadt hingegen finden sich in den Parks und Grünanlagen viele Hecken und Büsche. Hier können die Hasenartigen ihre Bauten geschützt anlegen.
Und direkt neben dem Bau finden sich unzählige Kaninchen-Supermärkte in Form von


Schrebergärten oder Kräutern auf Parkflächen. Sichere Behausungen und ein reich gedeckter Tisch zahlen auf das Fitnesskonto der Stadtkaninchen ein. Kein Wunder, dass es den Frankfurter Wildkaninchen so gut ging, dass ihre Zahl stetig anstieg. Auch Räuber wie Füchse, Greifvögel oder Marderartige müssen die Stadtkaninchen nicht fürchten. Fuchs und Co. gibt es zwar auch in Frankfurt, aber sie profitieren ebenfalls vom reichen Nahrungsangebot und bedienen sich lieber an den Mülltonen, anstatt einem flinken Wildkaninchen nachzujagen.
Was wir von der Natur lernen können
Die Umsiedlung vom Land in die Stadt schien eine Stressreaktion der Wildkaninchen auf immer weniger Nahrung und weniger Baumöglichkeiten auf dem Land zu sein. Für mein Buch Die unglaubliche Kraft der Natur: Wie Stress Tieren und Pflanzen den Weg weist habe ich unzählige solcher Stressantworten recherchiert und kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Da gibt es Pflanzen wie den Glatthafer, die sich an Zeiten der Dürre erinnern und bei einer erneuten Trockenperiode mehr Wasser einsparen können. Diese Form von „Stressgedächtnis“
bei Pflanzen ist ein völlig neues Phänomen, das die Wissenschaft immer mehr erforscht. Auch das mikroskopisch kleine Bärtierchen überrascht mit unglaublichen Fähigkeiten im Umgang mit Stress. Sind die Umstände ungünstig, trocknen die Bärtierchen aus und nehmen das sogenannte Tönnchenstadium ein. Mit diesem Trick werden sie zu regelrechten Superbären und können selbst extreme Temperaturen über Monate hinweg überstehen. Diese Superkräfte sind auch der Wissenschaft aufgefallen und bescherten den Bärtierchen ein Ticket zum Mond. Versuche zeigen, dass die Tiere sogar nach einer Reise zum Erdtrabanten mit Aufenthalt im All wieder aus ihrem Tönnchenstadium zum Leben erweckt werden konnten. Doch wer denkt, dass sich erinnernde Pflanzen und Bärtierchen mit Superkräften nicht mehr zu toppen sind, irrt. Die Meeresschneckenart Elysia marginata schießt mit ihrer Stressantwort den Vogel ab – oder besser gesagt den Kopf. Sind die Schnecken von einem Parasiten befallen, werfen sie ganz einfach ihren Körper ab und lassen sich einen gesunden nachwachsen. Dazu wird die Schnecke für einige Zeit zur Pflanze und betreibt Fotosynthese. Auf diese Weise kann sich vom Kopf her ein komplett neuer Körper entwickeln, der alle wichtigen Organe besitzt. Von wegen, Schnecken seien langweilig!
Fazit: Ohne Stress geht es nicht
Auch Herr Selye wusste bereits, dass ein Leben ohne Stress nicht möglich ist. Wir haben erst dann keinen Stress mehr, wenn wir tot sind. So sind die vielen Anforderungen von außen der Motor für die Evolution. Erst durch die vielen Herausforderungen im Leben werden Bakterien, Pilze, Pflanzen und Tiere inklusive wir Menschen dazu gezwungen, uns anzupassen. Um sich anzupassen, braucht es Weiterentwicklung. Und geht es nicht genau darum im Leben: sich weiterzuentwickeln? Nach der Recherche für mein Buch bin auch ich fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, unsere Haltung zum Stress zu überdenken. Wir können Stress immer als Wegweiser verstehen, der uns zeigt, dass es Zeit ist, etwas zu ändern. Wenn unser Lebensraum unsere Fitness in Mitleidenschaft zieht, weil zu viele Anforderungen an uns gestellt werden, zahlt es sich aus, darüber nachzudenken, woanders hinzugehen oder sich einer anderen Tätigkeit zuzuwenden. Stress fordert uns auf, uns selbst ehrlich zu fragen: „Was bin ich eigentlich für ein Tierchen und was brauche ich, um glücklich zu sein?“ Mit diesem Wissen lade ich Sie ein, Ihren Stress ebenfalls in einem neuen Licht zu sehen. Vielleicht ist er eine freundliche Erinnerung an Sie, etwas in Ihrem Leben zu ändern.
Lese-Tipps
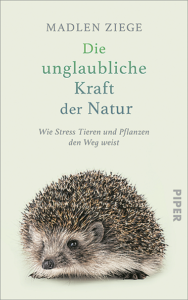
Madlen Ziege
Die unglaubliche Kraft der Natur. Wie Stress Tieren und Pflanzen den Weg weist. Piper, 240 S., 22 Euro, 2023












