Viel Glück im neuen Jahr – das sollen die kleinen „Glücksklee“-Blumentöpfe verheißen, die alljährlich zu Silvester auf den Markt kommen. Tatsächlich handelt es sich dabei um Sauerklee (Oxalis tetraphylla) aus Mexiko, bei dem alle Blätter grundsätzlich aus vier Einzelblättchen
bestehen. Ein Glücksklee (Trifolium repens) verdient aber seinen Namen gerade dadurch, dass er sich nur mit etwas Glück finden lässt. Die normalen Blätter von echtem Klee bestehen aus drei Blättchen, die fingerförmig angeordnet sind. Daher der wissenschaftliche Gattungsname Trifolium, also Dreiblatt. Bei nur einem von 5.000 Blättern sind vier Blättchen vorhanden – solche Seltenheiten gelten in vielen Kulturen als Glücksbringer. Ob Gene oder Umwelt zu Viererklees führen, wird schon seit Jahrzehnten diskutiert. Der Schlüssel zum Glück(sklee) ist zwar noch nicht gefunden, aber sein Versteck konnte eingegrenzt werden.
Ein Beitrag von Dr. Inge Kronberg
Innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler gibt es fast 300 verschiedene Trifolium-, also Klee-Arten. Wegen einer für Hülsenfrüchtler typischen Symbiose mit Knöllchenbakterien helfen Kleepflanzen, Luftstickstoff in pflanzenverwertbare Stickstoffverbindungen umzuwandeln. Das verbessert die Bodenfruchtbarkeit und kann Kunstdünger ersetzen. Klee ist eine wertvolle Futterpflanze für Weidevieh. Die Schmetterlingsblüten des Klees sind eine wichtige Bienentracht – Kleehonig ist beliebt. Wegen dieser günstigen Eigenschaften wurde vor allem der Weißklee (Trifolium repens L.) weltweit verbreitet. Es ist also kein Wunder, dass es großes züchterisches Interesse an der Genetik des Klees gibt, Glücksklee-Erkenntnisse sind dabei eher ein Randeffekt.
Genetik des Weißklees
Für klassische Vererbungsuntersuchungen nach dem Vorbild von Gregor Mendel braucht man reinerbige (homozygote) Linien. So etwas findet man beim Weißklee aus verschiedenen Gründen aber nicht: Zum einen sind die Pflanzen ausschließlich fremdbestäubt, was Inzucht verhindert und Gene ständig neu kombiniert. Zum anderen sind in Weißkleezellen nicht nur zwei, sondern gleich vier Chromosomensätze vorhanden. Weißklee entstand nämlich aus zwei europäischen Arten, die nach der Eiszeit verschmolzen. Weißklee trägt als Hybridart weiterhin die Chromosomensätze beider Arten, er ist nicht diploid, sondern allo-tetraploid (2n = 4x = 32). Anders als bei Tieren ist so eine Polyploidisierung bei Pflanzen recht häufig (Raps, Pflaume, Erdbeere); sie verleiht durch die Genvielfalt oft eine bessere Anpassungsfähigkeit und erweitert die ökologische Nische.

So entsteht ein Glückskleeblatt

Das Weißkleegenom ist also ausgesprochen mischerbig (heterozygot); im Erscheinungsbild gibt es Merkmalsvarianten bezüglich Blättchenzahl, Blattzeichnung oder Stielfarbe. In der modernen Genetik versucht man merkmalsbestimmende Gene zu finden, indem man nach bereits bekannten DNA-Sequenzen sucht. Treten solche „Marker“ gekoppelt mit dem Merkmal auf, lässt das auf ihre Nähe zum gesuchten Gen schließen. Als Marker dienen etwa kurze, nichtcodierende Basensequenzen in der DNA, die oft wiederholt werden (short tandem repeats). Bekannt sind sie eher von Analysen des genetischen Fingerabdrucks beim Menschen. Beim Weißklee wurden 22 solcher Marker und ihre Kopplung mit dem Glückskleemerkmal analysiert. Dadurch ließ sich ein DNA-Bereich eingrenzen, in dem mindestens ein rezessives Gen liegt, das für die Vierblättrigkeit codiert. Das Gen für die Dreiblättrigkeit ist aber dominant und unterdrückt die Entwicklung eines vierten Blättchens. Dieses dominante Dreiblattgen kann durch eine (somatische) Mutation im Blatt ausfallen, oder zumindest kann seine Aktivierung durch bestimmte Umweltbedingungen wie Temperatur und Nährstoffgehalt verhindert werden – ein Glücksklee entsteht! Die Vierblättrigkeit ist offenbar das ursprünglichere Merkmal, das zeigen auch die vielen Fiederblättchen anderer Hülsenfrüchtler, wie die von Erbse oder Wicke. Man kann es auch so ausdrücken: Eigentlich gibt es immer die Fähigkeit zum Glück(sklee), sie kann zwar durch vorhandene Anlagen unterdrückt werden, aber in einer geeigneten Umwelt wieder ans Licht kommen. Das sind doch glückliche Aussichten!
Tipps für die Suche nach Glücksklee
Haben Sie schon mal Glücksklee gefunden? Nein? Dann liegt das vielleicht nicht nur an dessen Seltenheit; vielleicht haben Sie einfach nicht richtig gesucht! Man braucht dazu Geduld, einen Blick für Feinheiten und Sinn für die natürliche Besonderheit – alles Eigenschaften, die tatsächlich Glück bringen können. Aussichtsreiche Fundstellen gibt es auf gut gedüngten Grünstreifen, Rasen oder Wiesen vor der ersten Mahd. Man sucht am besten im Frühling bei Sonnenschein, dann sind die Blättchen übersichtlich aufgeklappt. Die weiße Zeichnung der Blätter bildet beim Glücksklee ein Quadrat und kein Dreieck wie bei den restlichen Dreiern. Mit so einem Suchbild werden Einzelobjekte öfter gefunden, als es ihrer Häufigkeit entspricht – wenn man etwas übt. In der Evolution halfen Suchbilder den Sammelnden bei der Suche nach Nahrung, Werkstoffen oder eben auch Glücksklee! Der wissenschaftliche Name von Weißklee, T. repens, bezieht sich auf seine Fähigkeit, über Ausläufer ganze Flächen zu bewachsen. Jede Kleefläche entspricht einem Klon, also genetisch identischen Kleeblättern. Beim Suchen „scannt“ man am besten mit den Augen eine Kleefläche, das geht sogar bei großen Flächen rechtschnell. Wo man ein Viererklee entdeckt, sind oft noch weitere – findet man auf Anhieb keines, sucht man am besten gleich eine andere Kleefläche ab.
Weitere Besonderheiten
Übrigens gibt es (noch seltener) fünfblättrige Kleeblätter. Stehen die ersten drei Blättchen für Glaube, Liebe, Hoffnung und das vierte für Glück, soll das fünfte für Wohlstand sorgen. Es gibt aber auch bis zu zehnblättrige Kleeblätter – für diese ließen sich weitere gute Wünsche formulieren.
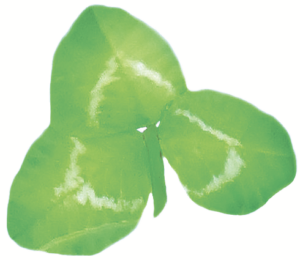


Dr. Inge Kronberg
Dr. Inge Kronberg ist promovierte Biologin, Fachautorin und Wissenschaftsjournalistin. Sie schreibt in Lehrbüchern und Fachzeitschriften über aktuelle Themen aus der Ökologie, Genetik und Evolutionsbiologie. Im Schulbereich ist sie als Autorin von Natura Oberstufe, Markl Biologie und verschiedenen Unterrichtsheften tätig.












