Viren haben stets unsere Geschichte beeinflusst, doch der Mensch schafft selbst die Voraussetzungen für neue Infektionskrankheiten. Weil wir die Welt verändern, lösen wir Pandemien aus, die wir dann nicht mehr beherrschen. Das Buch Die Rache des Pangolin zeigt nicht nur, wie das Coronavirus entstand, sondern auch, welche Rolle Tiere bei Pandemien spielen und wie der Schwund natürlicher Lebensräume und der Artenvielfalt neue Seuchen heraufbeschwört.
Ein Beitrag von Prof. Dr. Matthias Glaubrecht
Es beginnt immer im Verborgenen und bleibt unsichtbar. Aber so könnte es begonnen haben: Nachdem in China 2019 – ausgerechnet im „Jahr des Schweins“, das eigentlich im Zeichen von Wohlstand und Lebensfreude stehen sollte – die für die Tiere hoch ansteckende Afrikanische Schweinepest grassierte, kam es zu einer beispiellosen Versorgungskrise.
Übersprungshandlung – Von Wuhan in die Welt
150 Millionen Tiere, beinahe die Hälfte des Schweinebestandes der Volksrepublik, mussten gekeult werden, weitere Millionen starben an der Seuche. Daraufhin explodierte der Preis für Schweinefleisch, die Nachfrage nach Fleisch stieg – auch nach dem von Wild- und Farmtieren. Mit den Tieren, die vor allem aus dem subtropischen Süden durchs Land transportiert wurden, könnte ein Virus seinen Weg in die großen aufwachsenden Millionenstädte am Jangtse in Zentralchina gefunden haben.
So kam es auf dem Huanan-Tiermarkt in Wuhan, wo traditionell Wild- und Farmtiere angeboten wurden, sehr wahrscheinlich zum „spillover“ – dem Übersprung eines mutierten Erregers auf den Menschen. Was jüngste Studien inzwischen nahelegen: Dieser Markt wurde zum „superspreading“-Ereignis, von dem aus sich dann im Dezember 2019 eine neuartige Infektionskrankheit zur weltumspannenden Pandemie entwickelte.
Woher die Seuche kommt – Anatomie einer angekündigten Pandemie
Das bald dingfest gemachte Coronavirus Sars-CoV-2 ist ein winziger Erreger, mehr unscheinbares Erbmolekül samt Eiweißhülle als wirkliches Lebewesen. Und doch wurde es zum Auslöser der größten globalen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, beeinflusste das Leben weltweit in zuvor ungeahnter Weise, schickte nicht nur den ganzen Globus in Quarantäne, sondern bedrohte unsere Gesundheit und unsere globalisierte Wirtschaft. Als die Seuche durch Impfstoffe und Immunisierung nach mehr als zwei Jahren abebbte, dürften schätzungsweise statt der offiziell ermittelten rund sechs Millionen mehr als dreimal so viele Menschen an oder mit Covid-19 gestorben sein. Lange standen weltweit das Infektionsgeschehen und die wirtschaftlichen wie sozialen Folgen im Zentrum der Aufmerksamkeit; dagegen fanden Ursprung und eigentliche Ursache kaum Beachtung.
Dabei ist vor dem Ausbruch einer solchen Seuche wiederholt gewarnt worden. Und was auch übersehen wird: Covid-19 ist keineswegs eine „Naturkatastrophe in Zeitlupe“, wie Virologen uns glauben machen. Vielmehr liefert uns das Virus Anschauungsunterricht für Evolution in Echtzeit und die Ökologie im Anthropozän – zum einen dafür, wie Viren immer schon die Menschheit, ihre Geschichte und Geschicke beeinflusst haben, und zum anderen dafür, wie wir im geologischen Zeitalter des Menschen nun vermehrt selbst die Voraussetzungen für neue Seuchen schaffen.
Wenn Seuchen Geschichte machen
Da Infektionskrankheiten ein Teil unserer Umwelt sind, haben Plagen in der Vergangenheit stets auch Geopolitik gemacht. Viren und Bakterien gehören nicht nur seit Urzeiten zum Inventar der Evolution, sie sind auch die ältesten Bekannte des Menschen und Begleiter wie Wegbereiter der Menschheit, spätestens seit wir sesshaft und zu Ackerbauern und Viehhirten wurden. Vor allem dank jüngst möglicher molekulargenetischer Analysen erhalten wir neueste Einblicke in die Zusammenhänge und Beziehungen menschlicher Gesellschaften zur Sphäre der Viren und Bakterien, die überall auf der Erde die Entwicklung der Ereignisse mitgestaltet haben. Inzwischen beginnen Historiker*innen, die großen geschichtlichen Erzählungen – etwa über große Imperien oder die Kolonisierung Amerikas – in diesem Kontext der jeweiligen Umwelt besser zu verstehen. Von diesen Pathogenen ausgelöste Epidemien haben die Hochkulturen Mesopotamiens ebenso geprägt wie jene Mexikos; sie ließen mit dem Römischen Reich seinerzeit die am dichtesten bevölkerte und am engsten untereinander verbundene Gesellschaft der Alten Welt ebenso untergehen wie später das Reich der Azteken und anderer indigener Völker der Neuen Welt.
Pest und Pocken, Masern und Mumps, Tuberkulose und Typhus, nicht zu vergessen Influenza und Cholera sowie andere Pathogene haben lange nicht nur Schicksal gespielt; vielmehr haben die durch sie ausgelösten Epidemien in einem kaum zu überschätzenden Maße Geschichte geschrieben. Denn mehr noch als Kriege und Katastrophen sorgten massenhafte Krankheiten und nachfolgendes Chaos und Krisen für historische Meilensteine und für historische Weichenstellungen. Dabei brachten Seuchen nicht selten das Beste und das Schlechteste im Menschen hervor.
Zoonosen – die Ursache von Epidemien
In diesem Kontext spielte die Millionenmetropole Wuhan eine zwar zentrale, doch eher zufällige Verteilerrolle. Denn seinen eigentlichen Ursprung hat das neuartige Coronavirus in Hufeisennasen-Fledermäusen der Gattung Rhinolophus als tierischem Reservoir. Diese kommen mit mehr als einem halben Dutzend beschriebener Arten vor allem in der südchinesischen Provinz Yunnan, aber auch in den angrenzenden Provinzen Guangxi und Guangdong vor. Inzwischen wissen wir dank weiterer Nachweise, dass die nächsten Verwandten von Sars-CoV-2 in Rhinolophus-Fledermäusen weitverbreitet sind, von Myanmar und Thailand über Kambodscha bis Vietnam und Laos. Damit rückt die gesamte Region im Süden und Osten Asiens mit den zahlreichen natürlicherweise dort vorkommenden Wildtieren ebenso wie den vielen Farmtieren wie Schweine und Geflügel in den Fokus. Immerhin war beim ersten Sars-Ausbruch 2003 und 2004 eine Schleichkatze (Viverridae), der Larvenroller Paguma larvata (hierzulande oft irrtümlich als Zibetkatze bezeichnet), als Überträger dingfest gemacht worden.

Nachdem man dann bei vom Zoll in Guangdong und Guangxi beschlagnahmten Pangolinen ebenfalls ähnliche Coronaviren gefunden hat, gerieten diese Schuppentiere in Verdacht, den neuartigen Sars-Erreger als Zwischenwirt auf den Menschen übertragen zu haben. Die mit jeweils vier Arten in Asien wie in Afrika einst weitverbreiteten Pangoline gehören seit geraumer Zeit zu den am meisten illegal gehandelten Säugetieren und sind dadurch mittlerweile vom Aussterben bedroht. Da man allerdings in natürlichen Populationen etwa des Malaiischen Schuppentiers (Manis javanica) – von der Malaiischen Halbinsel und dem Norden Borneos sowie aus Thailand und Vietnam – keine weiteren eng verwandten Coronaviren nachweisen konnte, sind die Tiere als Überträger auszuschließen.
Wie der Mensch zur Verbreitung von Infektionskrankheiten beiträgt
So wenig die Pandemie die Schuld der Pangoline ist, so irreführend ist die Vorstellung, die Natur räche sich an uns. Vielmehr ist es der Mensch, der – wie ein entsprechender Blick auf die zoonotischen Ursachen für Pandemien zeigt – im Verlauf seiner jüngsten Geschichte im Wesentlichen selbst dazu beigetragen hat, dass sich neue Infektionskrankheiten über Kontinente hinweg ausbreiteten. Weltweit schlummern in Tieren – von Rhinolophus bis zu Ratten und Rindern – zahllose Erreger, darunter sowohl etwa Sars-Viren wie auch Pest-Bakterien, die immer wieder auf uns Menschen überspringen und Pandemien auslösen. Insgesamt sind mehr als 200 solcher Zoonosen bekannt, von Tollwut und (ursprünglich wohl auch einmal) Tuberkulose über die aus Afrika und Asien stammenden Pocken und die Pest sowie die in Zentralafrika entstandene Immunschwächekrankheit Aids und das hämorrhagische Fieber Ebola bis hin zu Hepatitis, Hanta und Hendra. Selbst so bekannte Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps und Röteln, so ließ sich erst unlängst nachweisen, stammen von Nutz- und Haustieren, von denen sie in historischer Zeit auf uns kamen und dabei anfangs verheerende Epidemien auslösten.
Immerhin gehen etwa zwei Drittel aller Infektionskrankheiten ursprünglich entweder auf domestizierte Tiere wie Schweine, Hühner oder Rinder zurück – mit denen viele Menschen bis heute gerade in ärmeren Ländern auf engstem Raum zusammenleben – oder auf seit jeher eng mit dem Menschen assoziierte Nagetiere, etwa Hausmäuse oder die den Pestfloh und seine Bakterien übertragenden Haus- und Wanderratten. Und ein weiterer Infektionsweg epidemischer Zoonosen führt von Wildtieren zum Menschen, bevor sich dann mutierte Erreger auch von Mensch zu Mensch verbreiten. Inzwischen sind wir immer weiter in die einst abgelegenen Lebensräume vieler Wildtiere vorgedrungen, mit denen wir über Wildtiermärkte oder Nutztiere in Berührung kommen – gerade in den bevölkerungsreichsten Regionen in Ostasien sowie in Zentral- und Westafrika. Befördert durch die Globalisierung gelangen neue Infektionskrankheiten aus einst abgelegenen tropischen Regionen um die Welt. So fand etwa das Aids-Virus über verzehrtes Schimpansenfleisch nachweislich bereits seit den 1920er-Jahren seinen Weg zum Menschen und aus Zentralafrika über die Karibik bis in die USA.
Wild gewordene Viren – warum wir es selbst in der Hand haben
Indem der Mensch heute immer mehr natürliche Ökosysteme in menschengemachte Lebensräume umwandelt und überall in engen Kontakt mit Wild- und Nutztieren kommt, erntet er unabsichtlich auch immer mehr der gefährlichen Infektionskrankheiten wie zuletzt Ebola oder Corona. Tödliche Viren kommen nicht plötzlich und unvermittelt aus der unberührten Wildnis abgelegener Urwälder zu uns; vielmehr lauert die Gefahr in den zu Nutzflächen des Menschen umgewandelten Habitaten – in neuen Agrarflächen und entlang der jüngsten Siedlungsränder. So macht es unsere moderne Welt immer wahrscheinlicher, dass Seuchen überspringen.
Im Anthropozän werden die Karten gleichsam neu gemischt und das Phänomen von Pandemien wird zur prägnanten Signatur unserer Moderne. Zum einen ist der Mensch mit seiner in den vergangenen Jahrzehnten sich immer enger vernetzenden Weltbevölkerung von mehr als acht Milliarden Menschen eine ideale evolutive Brutkammer für munter mutierende epidemische Viren; zum anderen lösen wir durch unsere Umweltveränderungen – von der breiten Entwaldungsfront gerade in tropischen Regionen bis zur Massentierhaltung unserer Nutztiere – Pandemien erst aus, die wir dann nicht mehr beherrschen. Paradoxerweise sind diese neuen Seuchen natürlichen Ursprungs, zugleich aber menschengemacht in dem Sinne, dass wir durch unsere Ressourcennutzung überhaupt erst die Voraussetzungen dafür schaffen. Damit aber – und das ist die gute Nachricht – sind Pandemien keineswegs unabwendbar.
Buchtipp
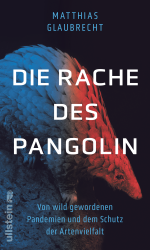
Das Buch Die Rache des Pangolin. Von wild gewordenen Pandemien und dem Schutz der Artenvielfalt erschien im November 2022 bei Ullstein. In einer spannenden Spurensuche zeigt der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht, woher das Coronavirus kommt, welche Rolle Tiere bei Pandemien spielen und wie die immer rasantere Vernichtung natürlicher Lebensräume und der Artenvielfalt neue Seuchen heraufbeschwört.
Wir müssen unseren Krieg gegen die Natur beenden
Corona ist ein Weckruf – ein unmissverständliches Signal dafür, dass unser Umgang mit der Natur und den Tieren letztlich auch uns Menschen gefährdet und dass es billiger ist, in die Prävention von Pandemien zu investieren, als die weltweit gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen weiterer Ausbrüche zu riskieren. Wir müssen deshalb ein Interesse daran haben und wirkungsvolle Maßnahmen entwickeln, um das weitere Schrumpfen von Lebensraum für Wildtiere zu verhindern; vor allem müssen wir die gefährlichen Wildtiermärkte dauerhaft schließen und verbieten sowie Verzehr und Handel von Wildtieren weltweit rigoros unterbinden, um zu verhindern, dass weitere Viren vom Tier auf den Menschen überspringen. Wir können nur hoffen, diese Krankheiten zu kontrollieren, wenn wir sie erkennen, bevor sie sich auf den Weg machen. Wir müssen die Mechanismen der Ausbreitung und Übertragung von Zoonosen besser verstehen lernen, vor allem aber die Überwachung jener Risikogruppen verbessern, die am engsten mit Wild- und Nutztieren in Kontakt kommen.
Unser Fokus darf also nicht länger allein auf der nachträglichen Entwicklung neuer Impfstoffe liegen; vielmehr müssen wir uns dringend dem Schutz von Natur und Artenvielfalt widmen. Es ist Zeit, für künftige Pandemien zu lernen und unseren Krieg gegen die Natur zu beenden.

Prof. Dr. Matthias Glaubrecht
ist Evolutionsbiologe, Biosystematiker und Wissenschaftshistoriker. Er war Forschungsdirektor am Berliner Museum für Naturkunde und Gründungsdirektor des Centrums für Naturkunde. Als Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg ist er am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) für den Wiederaufbau eines Naturkundemuseums als „Evolutioneum“ verantwortlich.












