Wenn man von der Kohlenstoffsenke hört, denkt man zunächst an Wälder, Moore oder gar an die Gletscher, doch ein wichtiger Kontributor ist der Ozean, im Speziellen die Tiefsee. Die Tiefsee kann man sich wie eine Wüste vorstellen. Es ist ein Ort der Extreme, mit hoher Salinität, niedrigen Temperaturen und enormem Druck. Doch der eigentliche limitierende Faktor für organisches Leben in der Tiefsee ist die Nahrungsverfügbarkeit, die ab 1.000 Meter Tiefe nahezu verschwindend gering ist. Dementsprechend sind Tiefseeorganismen auf jede Nahrungsquelle angewiesen. Und genau hier kommen Quallen ins Spiel.
Ein Beitrag von Nora S. Klasen
Ein im biogeochemischen Kreislaufmodell unterschätzter Faktor sind die sogenannten Jelly Falls – ein weltweites Phänomen, bei dem gelatinöses Zooplankton, der Einfachheit halber hier Quallen genannt, zum Meeresgrund absinkt und damit diesen mit Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor anreichert. Lange wurde angenommen, dass Quallen eine trophische Sackgasse sind. Mittlerweile gibt es aber genügend Beweise dafür, welche unmittelbare Nahrungsquelle sie für die Tiefsee darstellen.
Bis jetzt wurden dabei aber nur zwei dazu beitragende Taxa beobachtet: Scyphozoen (Schirmquallen, etwa die Ohrenqualle) und Thaliacean (Salben). Die gängigen Hydrozoen (wie die portugiesische Galeere) und Ctenophoren (Meereswalnüsse), die auch zu dem gelatinösen Zooplankton gehören, wurden bei solchen Events noch nicht beschrieben.
Was passiert bei den Jelly Falls genau?
Bei den jährlichen Quallenblüten sinken Scyphozoen und Thaliacean entweder lebendig oder tot als partikuläre organische Stoffmaterie (POM) herab. Beim Herabsinken wird das POM durch pelagische Organismen fragmentiert. Sobald es am Tiefseeboden angelangt ist, wird es von den mobilen Aasfressern als Erstes erreicht. Darauf folgt eine lange Kaskade von unter-schiedlichen Organismen, die sich von dem POM ernähren. Als Letztes folgt die sessile Mega- und Makrofauna, die sich durch die remineralisierenden Mikroorganismen auf dem angereicherten Meeresgrund ansiedeln kann. Dabei wird das POM zu gelöster organischer Materie (DOM) umgewandelt. Vom Herabsinken bis zur kompletten Auflösung der Quallen dauert es im Durchschnitt 10 bis 30 Tage. Durch den Kohlenstofftransfer von der Meeresoberfläche bis hin zu den Tiefen und der anschließenden Fixierung spricht man auch hier von einer Kohlenstoffsenke. Durch diesen Prozess wird die Tiefseewüste habitabel.
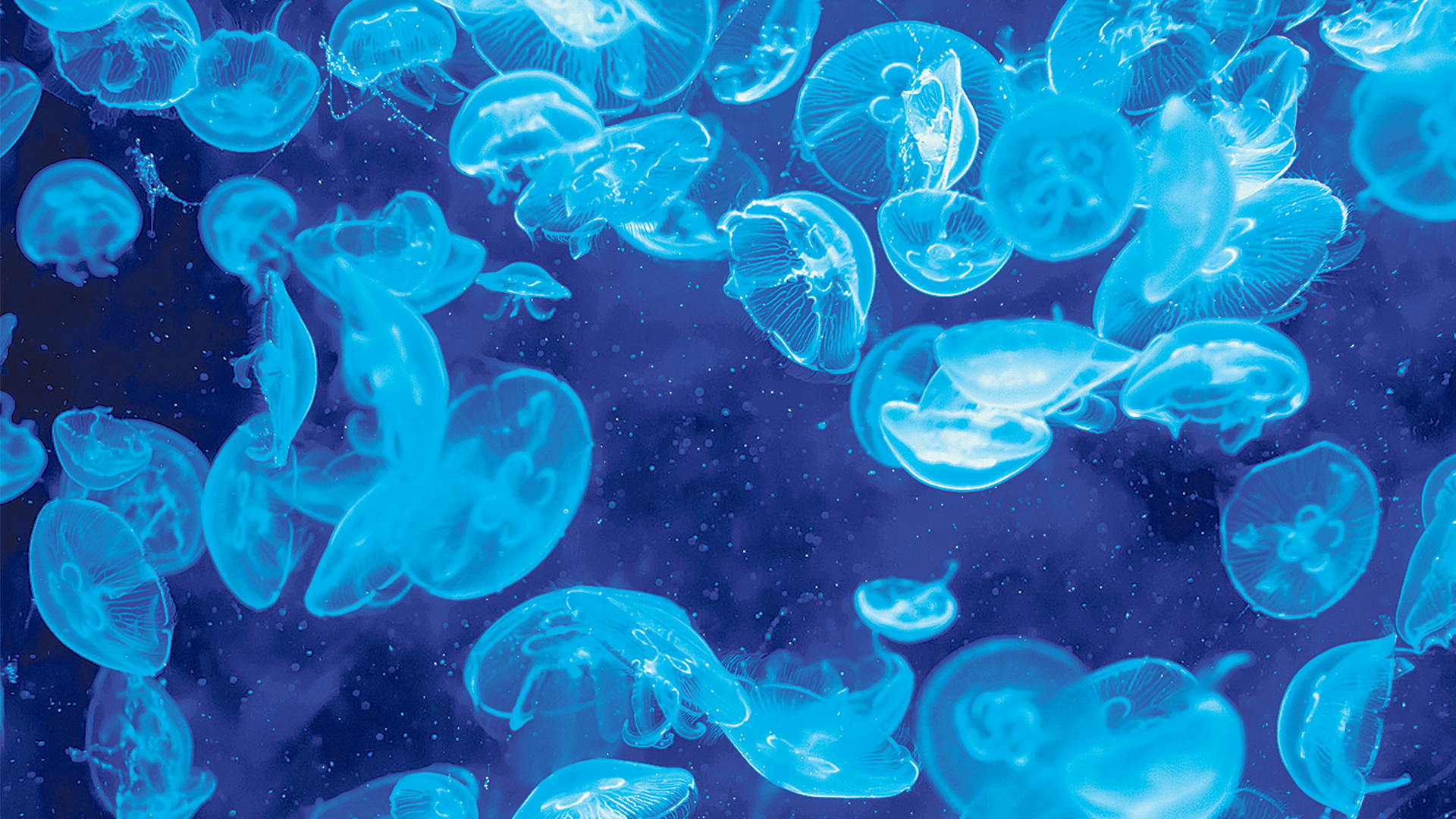
Gibt es auch negative Auswirkungen?
Leider gibt es die auch. Sobald erhöhte Wassertemperaturen und ausreichend Nährstoffe für die Quallen vorhanden sind, kommt es vor allem im Spätfrühling zu vermehrten Quallenblüten. Dabei akkumulieren sie am Meeresgrund zu Haufen, die sich auf großen Flächen ausbreiten können. Im Oman wurden im Jahr 2002 ganze 17 Prozent des Meeresbodens mit einer 7 Zentimeter dicken Schicht bedeckt. Die Folgen waren drastisch. Durch den fehlenden Sauerstofffluss kam es unter der Schicht unweigerlich zu einem hypoxischen Lebensraum, in dem jegliche sauerstoffabhängigen Organismen abstarben.
Was bedeutet das für die Zukunft?
Dabei spielen der Klimawandel und die Eutrophierung große Rollen, da durch die steigenden Wassertemperaturen und die zunehmende Nährstoffverfügbarkeit der ideale Lebensraum für Quallen geschaffen wird. Momentan kann man noch nicht vorhersagen, wo, wann und in welcher Dichte die Jelly Falls auftreten werden. Nur bei einer Sache ist man sich sicher – sie werden auftreten und das immer öfter.












