Jeder dritte Mensch ist aufgrund des Klimawandels und der damit einhergehenden Bedrohung der Lebensgrundlage ausgesprochen verwundbar – das zeigt der Weltklimarat IPCC in seinem neuesten Sachstandsbericht zum Thema „Klimawandel 2022: Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit“. Was das für unsere Zukunft bedeutet und warum das oberste Ziel nicht unbedingt lautet, Migration zu verhindern, klärt dieser Beitrag.
Ein Beitrag von Dr. Kathleen Hermans und Hanna Friedrich
Als eine Folge der klimatischen Entwicklung wandern betroffene Menschen bereits heute in andere Regionen ab. Dabei sind es vor allem der Meeresspiegelanstieg sowie Wetter- und Klimaextreme, beispielsweise lang anhaltende Dürren, die Menschen unmittelbar von ihrem Wohnort vertreiben. Vertreibung durch Extremwetterereignisse ist mittlerweile ein weltweites Phänomen, auch wenn es in erster Linie Bevölkerungen kleiner Inselstaaten im Pazifik und Menschen in Afrika und Asien betrifft. Laut dem Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) werden jährlich mindestens 20 Millionen Menschen aufgrund von Extremwetterereignissen innerhalb ihrer Landesgrenzen vertrieben, das entspricht der Einwohnerzahl Rumäniens. Der größte Teil der Betroffenen legt meist nur kurze Distanzen zurück, im Zusammenhang mit Klimaextremen ist internationale Migration deutlich seltener. Einige Menschen kehren auch, wenn möglich, zu einem späteren Zeitpunkt an ihren Wohnort zurück
Umweltbedingte Migration ist vielfältig
Abwanderung als Folge des Klimawandels hat sehr unterschiedliche Facetten und spielt nicht nur bei Extremwetter eine Rolle. Auch schleichende, über Jahre stattfindende Umweltveränderungen können Migration beeinflussen. In den vergangenen Jahren wurde verstärkt dazu geforscht, wie sich das Migrationsverhalten von Menschen verändert, wenn das Klima sich erhitzt oder die Böden unfruchtbar werden. Dabei haben Forscher*innen festgestellt, dass Umweltveränderungen Migration einerseits begünstigen, andererseits aber auch verhindern können.
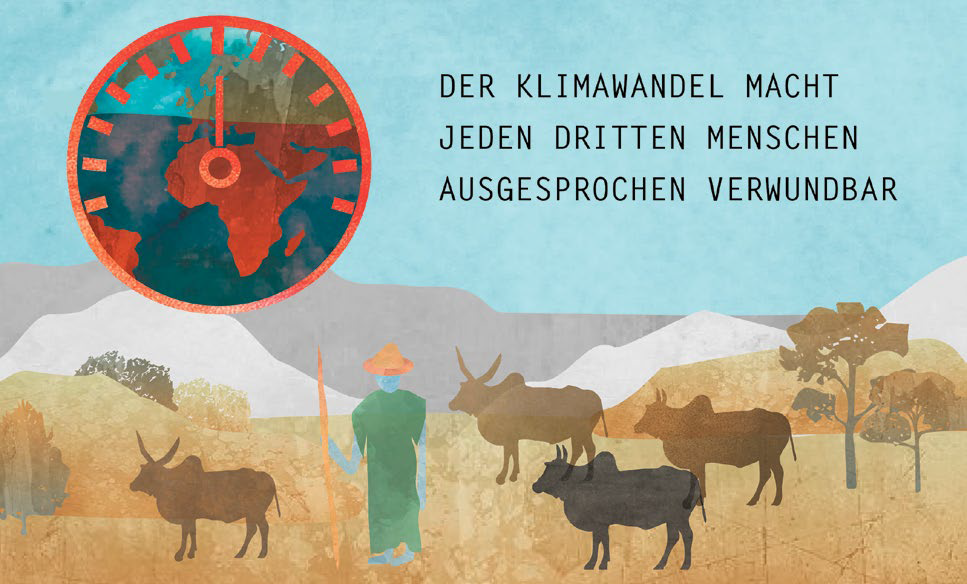
Warum ist das so?
In vielen ländlichen Gemeinschaften im globalen Süden hängt das Leben unmittelbar von natürlichen Ressourcen ab. Für ihre Nahrungsmittelproduktion sind Landwirt*innen beispielsweise auf die natürliche Fruchtbarkeit der Böden sowie den Niederschlag angewiesen, da ihnen oftmals Bewässerungssysteme und geeignete Düngemittel fehlen. Wenn sich die Verfügbarkeit von Ressourcen verschlechtert, etwa weil Niederschläge ausbleiben, sind die bäuerlichen Existenzgrundlagen oftmals direkt bedroht. Wenn außer der Landwirtschaft keine anderen Einkommensquellen verfügbar sind, wächst die Notwendigkeit, das Haushaltseinkommen temporär oder langfristig durch Abwanderung sicherzustellen. Dafür kann ein Haushaltsmitglied in der nächsten Stadt arbeiten gehen, oder die ganze Familie zieht dorthin, wo es ausreichend Arbeit gibt. Allerdings können es sich nicht alle Menschen leisten, ihren Wohnort zu verlassen. Migration ist oftmals teuer und funktioniert besser, wenn Menschen in soziale Netzwerke eingebunden sind und sich mit anderen Migrant*innen über ihre Migrationserfahrung austauschen können. Wenn Betroffene weder über Kontakte noch über finanzielle Mittel verfügen, kann der Klimawandel dazu führen, dass sie zwar abwandern möchten, aber nicht können. Dies betrifft in der Regel die Menschen, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind – sie sind zu arm, um abwandern zu können. Ein weiterer Grund, warum Menschen sich gegen die Abwanderung entscheiden, ist die Verbundenheit mit ihrer Heimat. Viele Menschen verspüren gar nicht den Wunsch, ihre Heimat zu verlassen, obwohl sich die ökologischen Rahmenbedingungen verschlechtern. Vielmehr wollen sie Lösungen vor Ort suchen.
Viele Faktoren bestimmen die Migrationsentscheidung
Prinzipiell hat uns die Forschung gezeigt, dass Migration nicht nur vom voranschreitenden Klimawandel beeinflusst wird, sondern von mehreren Kontextfaktoren abhängt, die miteinander interagieren. Finanzielle Mittel, soziale Netzwerke, persönliche Wünsche, politische Institutionen sowie Veränderungen von Klima oder Umwelt beeinflussen Menschen in ihrer Entscheidung, zu bleiben oder zu gehen. Das heißt, obwohl immer mehr Menschen die negativen Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen, ist es abhängig von ihren Umständen und Möglichkeiten, ob sie abwandern können oder wollen.

Manche Regionen werden faktisch unbewohnbar
Mit Blick auf die Komplexität und Vielfalt von Migrationsdynamiken sind Zahlen und Prognosen, die klimawandelbedingte Abwanderungsströme messen oder vorhersagen wollen, ausgesprochen schwierig zu erstellen. Eine Vielzahl der bisherigen Versuche, sogenannte Klimaflüchtlinge zu beziffern, haben keine belastbaren Ergebnisse gebracht. Verwendete Zahlen müssen daher immer kritisch auf ihre wissenschaftliche Methodik hinterfragt werden. Vor allem in den Medien ist das Narrativ verbreitet, der Klimawandel treibe mehrere Millionen Menschen nach Europa. Diese Schlagzeilen sorgen immer wieder für Aufmerksamkeit, blenden aber die Komplexität von Migrationsdynamiken aus und informieren nicht ausreichend über die Lebensumstände der Betroffenen. Vielmehr schüren sie häufig Angst vor zurzeit nicht nachweisbaren riesigen Fluchtbewegungen vom globalen Süden in den Norden. Fest steht jedoch, dass es vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels zu einer Zunahme klimabedingter Migration kommt. Weltweit sind stets mehr Menschen vom Klimawandel betroffen, und Tatsache ist, dass manche Regionen im globalen Süden in Zukunft unbewohnbar werden. Allerdings gibt es noch wesentliche Wissenslücken dahin gehend, wie genau diese Abwanderungen aussehen und wie umfangreich sie in Zukunft sein werden.
Was die Politik tun kann
Nicht zuletzt wegen der gängigen Interpretation von Migration als Bedrohung wird in Europa oft gefragt, wie klimabedingte Migration vermieden werden kann. Allerdings ist das nicht unbedingt immer die richtige Frage. Vermeidung von Abwanderung allein macht keinen Sinn, da manche Regionen wie gesagt zukünftig unbewohnbar werden. Migration gehört außerdem schon immer zum Verhalten von Menschen und kann nicht per se als gut oder schlecht bewertet werden. Mobil zu sein oder zu werden, kann sowohl positive als auch negative Effekte für das menschliche Wohlergehen haben. Abwanderung kann eine Anpassungsstrategie sein, um mit schwierigen Lebensumständen zurechtzukommen. Viel wichtiger ist deshalb die Frage, wie Menschen anhand von Migration ihr Wohlergehen steigern können. Politische Lösungsansätze sollten daher darauf abzielen, positive Effekte von Migration zu unterstützen und negative zu minimieren sowie die betroffenen Regionen und Menschen zu unterstützen, beispielsweise anhand von Umsiedlungsmaßnahmen, Unterstützung diverser Formen von Migration sowie Erleichterung sicherer Migrationsbewegungen.

Dr. Kathleen Hermans
Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO)
Hanna Friedrich
Projektassistentin der Nachwuchsforschungsgruppe MigSoKo zum Thema Umweltmigration am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), Leipzig












