Es ist unumstritten: Beruflicher Erfolg hängt von einer guten Ausbildung ab. In den letzten Jahrzehnten hat allerdings auch der Wert von sozialen Fähigkeiten wie Kooperationsbereitschaft erheblich zugenommen. Fähigkeiten wie diese lassen das berufliche Miteinander besser gelingen. Und dafür sind typische menschliche Verhaltensmuster verantwortlich.
Ein Beitrag von Prof. Dr. Matthias Sutter
Die fachliche Ausbildung allein genügt heutzutage kaum mehr für eine dauerhafte Arbeitsstelle und einen guten Verdienst. Neben technischen, handwerklichen oder analytischen Fertigkeiten muss man auch soziale Fähigkeiten mitbringen. Kooperationsfähigkeit ist eine davon, und zwar eine zentrale. Was Kooperation in Gruppen bedeutet und warum sie für den Erfolg von Zusammenarbeit so wichtig ist, lässt sich sehr treffend anhand einer alten chinesischen Parabel veranschaulichen.
Gelingende Teamarbeit vs. Trittbrettfahrerverhalten
Jeder einzelne Gast aus der Parabel wollte offenbar auf Kosten der anderen feiern. Erfolgreiches Miteinander kann jedoch nur gelingen, wenn alle im Team einen Beitrag dazu leisten. Fußballteams sind nachweislich erfolgreicher, wenn jede*r Spieler*in zusätzliche Laufwege in Kauf nimmt, um Fehler anderer auszubügeln. Forschungsteams bringen ihre Projekte eher zu einem guten Ende, wenn sich alle an der Projektarbeit beteiligen und nicht darauf vertrauen, dass ein anderes Teammitglied schon die mühsamen Arbeitsschritte übernehmen wird. Unternehmenskooperationen sind häufig erfolgversprechender, wenn Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen miteinander koordiniert werden. Und Arbeitsteams funktionieren besser, wenn wichtige Informationen geteilt und rasch weitergegeben werden. Das Problem besteht darin, dass es in diesen und vielen anderen Situationen Anreize gibt, die eigenen Anstrengungen etwas zurückzunehmen und zu hoffen, dass die anderen sich anstrengen. Menschen, die so denken und handeln, werden häufig als Trittbrettfahrer*innen bezeichnet. Wenn sich dann in einem Team alle – oder fast alle – so verhalten, dann kann das Gemeinwohl nicht gedeihen. Das wirft die Fragen auf, wie Kooperation in Gruppen gelingen kann und wie vermieden werden kann, dass Teammitglieder nur Wasser statt Wein beitragen.
Die Parabel von der chinesischen Hochzeit
„Zwei Brautleute hatten nicht viel Geld, aber dennoch waren sie der Meinung, dass bei ihrer Hochzeit viele Menschen mitfeiern sollten. ‚Geteilte Freude ist doppelte Freude‘, dachten sie. Sie beschlossen, ein großes Fest mit vielen Gästen zu feiern. Um dies zu ermöglichen, baten sie die Eingeladenen, je eine Flasche Wein mitzubringen. Am Eingang würde ein großes Fass stehen, in das sie ihren Wein gießen könnten; und so sollte jeder die Gaben des anderen trinken und jeder mit jedem froh und ausgelassen sein. Als nun das Fest eröffnet wurde, liefen die Kellner zu dem großen Fass und schöpften daraus. Doch wie groß war das Erschrecken aller, als sie merkten, dass es Wasser war. Versteinert saßen die Gäste da, als ihnen bewusst wurde, dass jeder von ihnen gedacht hatte: ‚Die eine Flasche Wasser, die ich hineingieße, wird niemand schmecken.‘“
Die zwei Auslöser für konditionale Kooperation
Viele Menschen kooperieren konditional. Das bedeutet zum einen, dass sie bereit sind, zu kooperieren, wenn sie sehen, dass andere auch kooperieren. Dieses Verhaltensmuster hat damit zu tun, dass das Verhalten anderer häufig als sozial angemessenes Verhalten interpretiert wird. Wenn also viele andere Menschen kooperieren, dann wird das so wahrgenommen, als ob die soziale Norm in diesen Gruppen Kooperation ist – und eben nicht Trittbrettfahrerverhalten. Da auch vielen Menschen daran liegt, in ihrem Umfeld einen guten Eindruck zu hinterlassen, erhöht sich in diesem Szenario folglich die Kooperationsbereitschaft, weil man sonst in seinem Umfeld einen schlechten Eindruck hinterlassen würde. Konditionale Kooperation bedeutet zum anderen, dass Menschen bereit sind zu kooperieren, wenn sie erwarten, dass andere das auch tun. Um im Beispiel der Parabel zu bleiben: Vielleicht haben die Hochzeitsgäste ja auch erwartet, dass alle anderen nur Wasser in das Fass schütten, und deswegen wollte niemand der Dumme sein und allein Wein mitbringen. Hätten die Gäste dieser Theorie zufolge erwartet, dass alle anderen Wein in das Fass gießen, hätten sie vermutlich auch Wein mitgebracht. Das legen zumindest alle Studien zur konditionalen Kooperationsbereitschaft von Menschen nahe. Die Erwartungshaltung hat deshalb einen entscheidenden Einfluss auf gelingendes Miteinander in Gruppen. Wir selbst müssen den Wandel vorleben. Neben der konditionalen Kooperation gibt es einen weiteren wesentlichen Faktor, der für das Kooperationsniveau in Gruppen bedeutend ist. Mahatma Gandhi hat diesen Faktor mit einfachen Worten ganz wunderbar beschrieben: „Wir selbst müssen den Wandel vorleben, den wir von der Welt erwarten.“ Kooperation in Gruppen ist substanziell höher, wenn ein oder mehrere Gruppenmitglieder mit gutem Beispiel vorangehen. Andere Gruppenmitglieder passen sich an kooperatives Verhalten anderer häufig an. Eine besondere Rolle kommt dabei Vorgesetzten zu. Deren kooperatives Verhalten verursacht besonders starke Nachahmung, während egoistische Vorgesetzte, also die Trittbrettfahrer*innen, Kooperation zwar häufig erwarten, Teammitglieder dann aber so wenig wie möglich zum Teamerfolg beitragen. Führung funktioniert nur durch gutes Vorleben. Wenn jemand mit schlechtem Beispiel vorangeht, bricht Kooperation in Teams schnell vollkommen zusammen, weil sich niemand von Trittbrettfahrer*innen ausnutzen lassen will. Diese Einsichten zum Gelingen oder Misslingen von Kooperation gelten in allen Lebensbereichen, in Schulen, in Familien, in Unternehmen und generell für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft.
Buch
Tipp
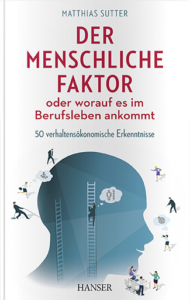
Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt.
Matthias Sutter: Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt. 50 verhaltensökonomische Erkenntnisse
München: Hanser Verlag, 2022.
Beitragsbild | © pch.vector – Freepik

Prof. Dr. Matthias Sutter
ist Direktor am Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und Professor für Experimentelle Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln und Innsbruck. Er zählt laut FAZ zu den einflussreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum.












