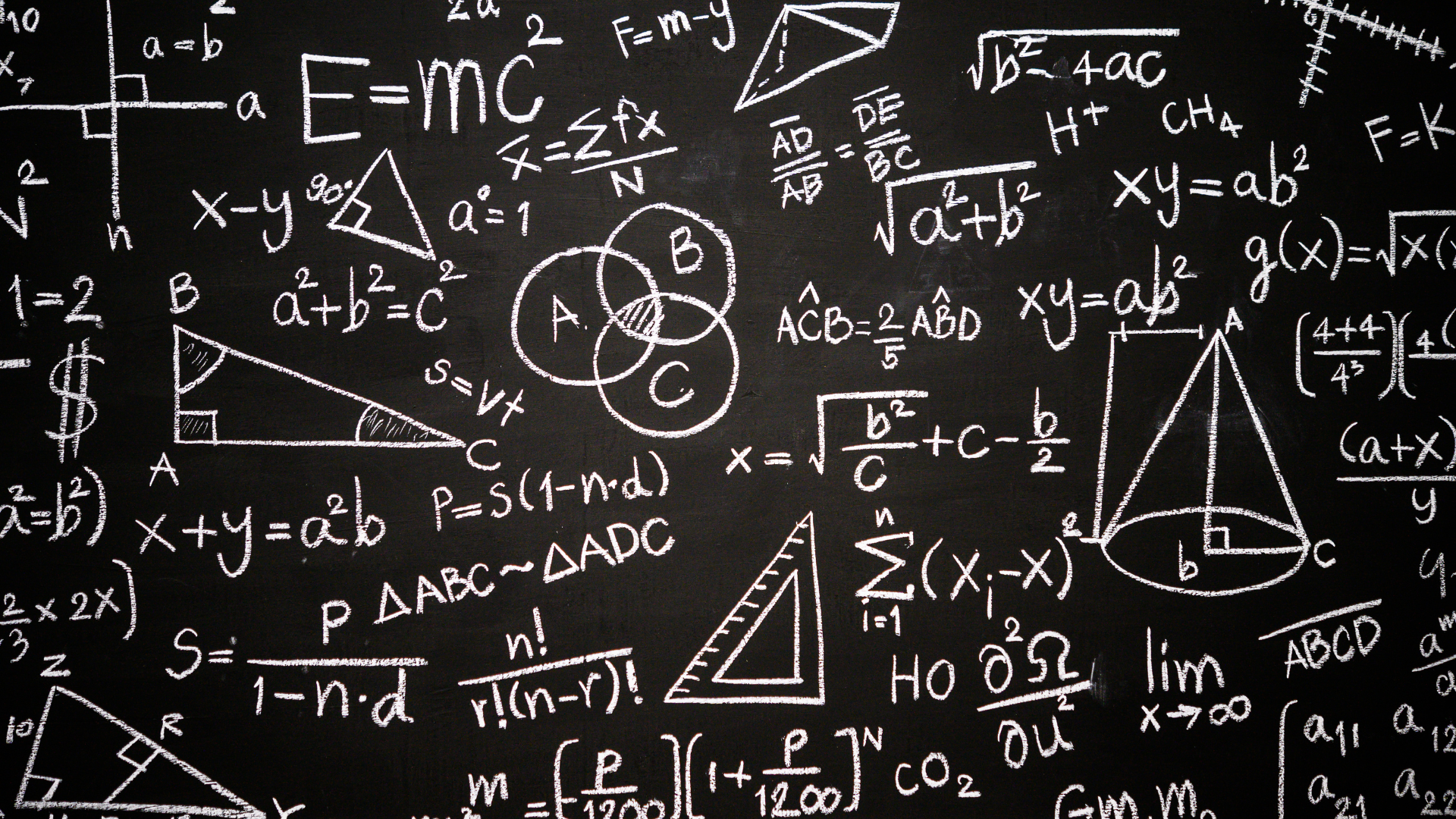Beim problemorientierten Chemieunterricht denken die meisten Lehrkräfte sicher an Erarbeitungen anhand von Experimenten oder experimentellen Daten. Doch es geht auch spielerischer, nämlich durch ein Mystery. Wie genau die Mystery-Methode auf spannende, rätselhafte und aktivierende Weise angewendet werden kann, zeigt dieser Beitrag anhand der Erarbeitung der Daniell-Zelle.
Ein Beitrag von Jana Buchholz und Niklas Schneeweiß
Mysterys sind eine mittlerweile angesehene Lernmethode. Sie beruhen auf einer Rätselgrundstruktur. Es müssen dabei Informationen zusammengetragen und miteinander in Beziehung gesetzt werden, um ein Rätsel zu lösen. Bei einem Mystery erscheinen die Hinweise zunächst ungeordnet. Lernende müssen somit die Hinweise richtig strukturieren, um die Problemfrage zu beantworten. Die Hinweise werden in der Regel in Form von 20 bis 30 Hinweiskarten gegeben, die auch irrelevante Informationen enthalten können. Dabei müssen Mysterys keinen Verlust an Fachlichkeit bedeuten, und die Rätselkarten können auch ohne inhaltliche Vorwegnahmen für die Lernenden gestaltet werden.
Die Mystery-Methode im Unterricht
Um die Daniell-Zelle im Unterricht zu erarbeiten, wurde das klassische Verfahren ein wenig adaptiert. Einerseits wurde die Anzahl der Hinweise reduziert. Zudem müssen die Informationen der Hinweiskarten von den Schüler*innen unter Einbezug von Vorwissen (Verdrängungsreihe der Metalle und Reaktionen von Metallen in Metallsalzlösungen) gedeutet werden, bevor sie miteinander in Beziehung gebracht werden können. Zentrale Erkenntnisse der Stunde werden nicht einfach als Informationen auf den Hinweiskarten verraten, sondern müssen von den Schüler*innen erarbeitet werden. Die Stunde reiht sich in die Elektrochemie der gymnasialen Oberstufe ein. Ziel der Unterrichtsstunde ist es, dass die Schüler*innen den Aufbau der Daniell-Zelle anhand des Mysterys eigenständig entwickeln. Dabei sollen sie darauf eingehen, dass die Daniell-Zelle aus zwei getrennten Kammern besteht, dass je eine Kupfer- und Zinkelektrode in einer Metallsulfatlösung vorliegt und dass eine poröse, ionendurchlässige Mittelwand vorhanden sein muss. Relevante Vorstellungen der Schüler*innen zur Leitfähigkeit von Salzlösungen (z. B. dass Elektronen mit Ionen transportiert werden) können hier noch nicht aufgegriffen werden. Entsprechende Aussagen sollten aber in einer Folgestunde diskutiert werden.

Verschiedene Hinweiskarten im Stil von antiken Laborjournaleinträgen führen die Schüler*innen durch das Mystery
Schritt 1: Der Einstieg
Die Problematisierung erfolgt durch ein rätselhaftes Zitat: „Durch Johns besondere Bauteil-Bauweise bekamen die Betreiber beständige Telegrafen.“ Der rätselhafte Einstieg soll motivieren. Es wurde ein historischer Kontext (Telegrafen) gewählt, da dort Daniell-Zellen eine bedeutende Rolle spielten. Die Lernenden sollen ihre spontanen Ideen zu dieser Aussage nennen. Diese werden an der Tafel festgehalten, jedoch nicht weiter kommentiert. Mögliche Äußerungen sind: Batterien, Stromleitungen, rostfreier Stahl.
Schritt 2: Die Erarbeitung
In der Erarbeitungsphase kommen die Hinweiskarten zum Einsatz. Sie wurden im Stil von Laborjournaleinträgen des mysteriösen „John“ gestaltet. Ohne es zu wissen, befinden sich die Lernenden somit auf den Spuren von John Frederic Daniell, dem Erfinder der Daniell-Zelle. Die gestalteten Hinweiskarten sollen lediglich zum Denken anregen, zentrale Erkenntnisschritte werden nicht auf den Karten vorweggenommen. Somit ist ein hohes Maß an Eigenaktivität notwendig, um das Lernziel zu erreichen. Zur Differenzierung dienen einerseits Kartensets, die in ihrem Offenheitsgrad variieren, und andererseits zusätzliche Hinweise, die nach Bedarf verteilt werden. Erfahrungsgemäß sind Gruppen von drei bis vier Schüler*innen eine zielführende Sozialform, da sie sich so über die Rätsel austauschen können. Während der Erarbeitung hält sich die Lehrkraft im Hintergrund. Bei Schwierigkeiten wird auf relevante Hinweiskarten verwiesen. Für einige Schlüsselschwierigkeiten stehen ergänzende Hinweiskarten bereit (s. Download).
Download
Umfangreiches Zusatzmaterial
Unerfahrenen Rätsler*innen kann strukturelle Unterstützung in Form eines Arbeitsblatts angeboten werden. Indem die Schüler*innen die zentrale Erkenntnis jedes Hinweises festhalten, wird ihnen die spätere Verknüpfung erleichtert. Diese Unterstützung kann auch als optionales Angebot eingeführt oder zur Differenzierung genutzt werden. Das Arbeitsblatt, einen Vorschlag zur Unterrichtsgestaltung sowie eine Übersicht über die Hinweiskarten und die antizipierten Erkenntnisse finden Sie hier:
Schritt 3: Die Sicherung
In einer optionalen Plateauphase können die einzelnen Erkenntnisse vorgestellt und erläutert werden. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn während der Erarbeitung viele alternative Deutungen festgestellt wurden. Zur Visualisierung können die Tabellen und Hinweiskarten beispielsweise unter einer Dokumentenkamera präsentiert werden. Im Anschluss daran stellen die Schüler*innen ihre Beschreibungen der Bauweise vor. Dabei sollte festgehalten werden:
- Kupfer- und Zinkelektrode in Metallsulfatlösungen (oder andere hinreichend unterschiedliche Metalle in ihren Metallsulfaten)
- Trennung der Reaktionen (Oxidation und Reduktion)
- Durchlässigkeit der Trennwand für Ionen
- Verbindung durch Ionen
Schließlich klärt die Lehrkraft auf, dass das gesuchte Bauteil die sogenannte Daniell-Zelle, benannt nach John Frederic Daniell, ist. Die Daniell-Zelle wird als galvanische Zelle und Vorläufer moderner Spannungsquellen eingeführt. Dabei kann der Fachbegriff der Salzbrücke eingebracht werden. Um die Stunde abzuschließen, sollen die Schüler*innen die Erkenntnisse zusammenfassen und eine Lösung für das Rätsel nennen (z. B. Telegrafen brauchen Strom, Johns Bauteil liefert Strom, Besonderheit ist: Trennung der Reaktionen, Verbindung durch Salzbrücke).
Die Schüler*innen sind ratlos?
Falls schon während der Erarbeitung festgestellt wird, dass die Schüler*innen keine Ideen zur Bauweise haben, können auch Tipps formuliert werden, etwa solche, die jemand wie John beachten sollte, wenn er eine Stromquelle konstruieren möchte. Anstelle des Lehrvortrags zur Daniell-Zelle könnten die Schüler*innen dann als Hausaufgabe überprüfen, inwiefern die Daniell-Zelle diese Tipps umsetzt.

Jana Buchholz
war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Georg-August-Universität Göttingen und ist Lehrkraft für Biologie und Chemie am Gymnasium Ernestinum in Rinteln.

Niklas Schneeweiß
war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leibniz Universität Hannover und ist Lehrkraft für Biologie und Chemie an der IGS List in Hannover.