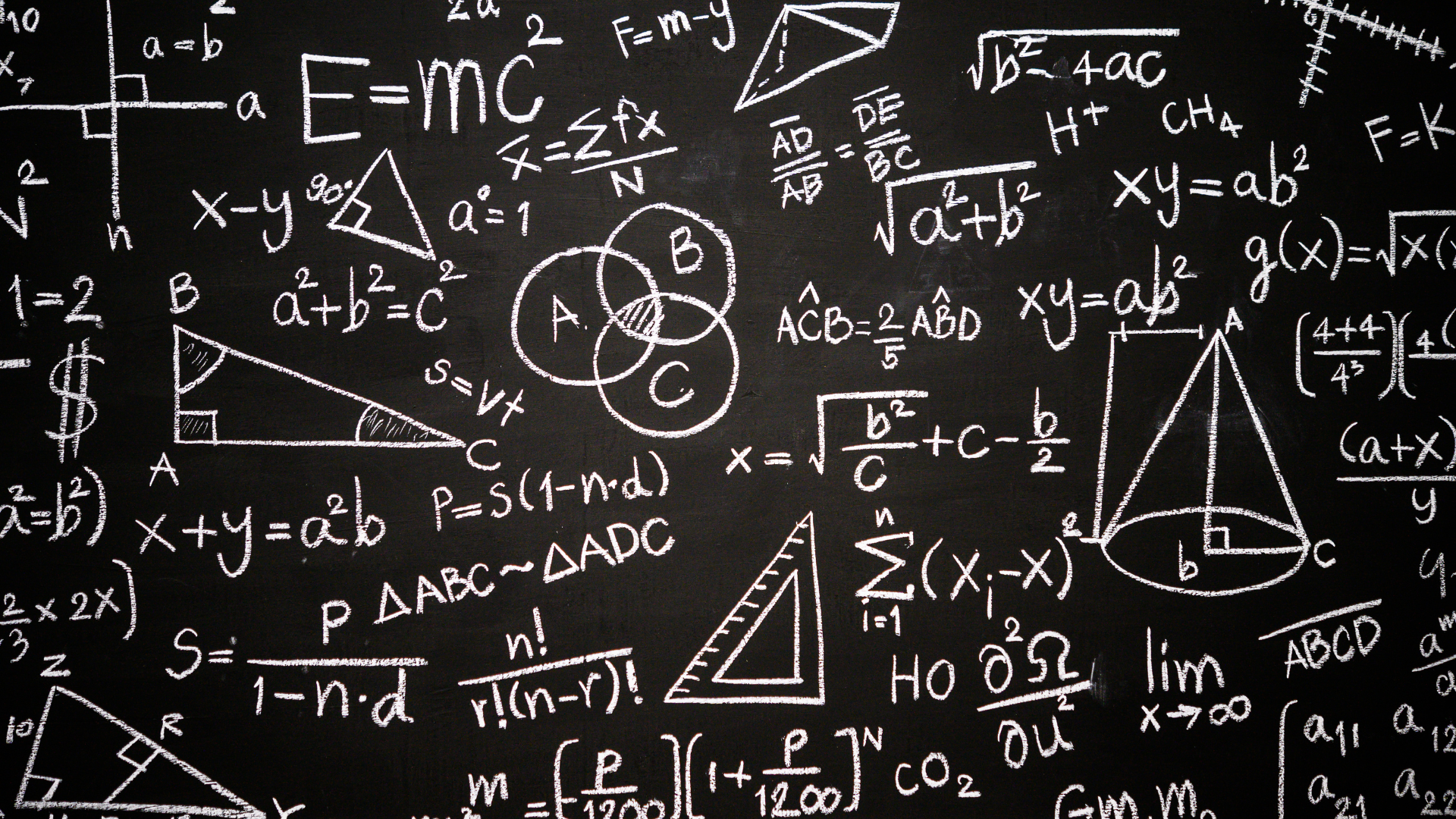Ist es möglich, kritisches Denken zu unterrichten? Und wenn ja, wie? Diese Fragen beschäftigen die Bildungsforschung seit Jahrzehnten. Mittlerweile existiert eine konsensfähige Definition, die Haltung und Fähigkeiten des kritischen Denkens so beschreibt, dass sie gezielt unterrichtet werden können. Zahlreiche Studien untersuchen seitdem empirisch, wie Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden können, kritisches Denken zu lernen.
Die Erkenntnis, den eigenen Verstand kritisch nutzen zu können, ist eine Errungenschaft der Aufklärung. Seit den 1980er Jahren existiert eine konkrete Definition von kritischem Denken, die eine Expertenkommission der American Philosophical Association aus dem Forschungsstand heraus entwickelt hat. Demnach gehört zum kritischen Denken einerseits die grundsätzliche Bereitschaft, Dinge infrage zu stellen und ihnen auf den Grund zu gehen – also eine kritische Grundhaltung. Zum anderen braucht es spezifische kognitive Fähigkeiten, um Fragen aufwerfen zu können, eigenständig zu recherchieren, Informationen zu analysieren, zu evaluieren und schließlich zu begründbaren und zu erklärbaren Urteilen zu gelangen. Insbesondere im MINT-Bereich sind kritische Beiträge zu aktuellen Debatten und fundierte Urteile zu Themen wie dem Umgang mit den Folgen der Klimaerwärmung, Fragen der Künstlichen Intelligenz (z. B. autonomes Autofahren) usw. nur auf Grundlage solcher kognitiven Fähigkeiten möglich. Insofern ist die Förderung von kritischem Denken vor allem auch für die MINT-Fächer und die naturwissenschaftliche Grundbildung von Schülerinnen und Schülern von großer Bedeutung.
Ist es möglich, kritisches Denken gezielt zu unterrichten?
Aufbauend auf der oben genannten und in zahlreichen Details ausgeführten Definition des kritischen Denkens gibt es mittlerweile eine Vielzahl von empirischen Forschungsergebnissen zu dieser Frage. Auf der Grundlage von über 800 einzelnen empirischen Studien kommen der Bildungsforscher Philip C. Abrami und Kollegen in einer Metaanalyse von 2015 zu dem Ergebnis, dass es grundsätzlich möglich ist, kritisches Denken im Unterricht zu fördern – und zwar mit Blick sowohl auf die kritische Grundhaltung als auch auf die spezifischen kognitiven Fähigkeiten. Dies gilt über alle Altersstufen der Schülerinnen und Schüler hinweg und sowohl für MINT- Fächer als auch für andere Fächer.
Wie kann man kritisches Denken grundsätzlich fördern und vermitteln?
Die Autoren stellen fest, dass kritisches Denken auf verschiedene Weise im Unterricht eingebettet sein kann: (1) explizit und unabhängig von einem bestimmten Thema, (2) ausschließlich anhand eines konkreten Themas, wobei die Prinzipien des kritischen Denkens im Unterricht offengelegt und explizit angesprochen werden, (3) anhand eines konkreten Themas, ohne dass Aktivitäten des kritischen Denkens explizit offengelegt werden, und (4) als Kombination von allgemeinen Prinzipien des kritischen Denkens und der zusätzlichen Verflechtung mit einem oder mehreren Unterrichtsinhalten. Dieser letzte Ansatz stellt sich als besonders effektiv heraus, wenngleich auch mit den anderen Ansätzen positive Ergebnisse erzielt werden können.
Außerdem gehen Abrami und Kollegen der Frage nach, welche didaktischen Mittel zur Förderung von kritischem Denken besonders geeignet sind. Sie unterscheiden zwischen dialogbasiertem Lernen – darunter fällt eine Vielzahl von Mitteln von der lehrerzentrierten Interaktion über Kleingruppenarbeit bis hin zu (formalen) Gruppendiskussionen – und Mentoring und anwendungsnaher Instruktion. Dazu zählen sie angewandtes Problemlösen, (Plan-)Spiele, Simulationen oder Rollenspiele. Die Metaanalyse zeigt, dass sowohl dialogbasiertes Lernen als auch anwendungsnahe Instruktion und Mentoring für sich genommen wirksame Methoden sind, um kritisches Denken zu fördern. Idealerweise werden sie jedoch miteinander kombiniert.
Kritisches Denken trainieren: ein Beispiel
Zvia Kabermann und Yehudit Judy Dori (2009) prüften in einer Studie, inwiefern kritisches Denken – hier verstanden als Fähigkeit, komplexe kritische Fragen zu stellen und dann zu bearbeiten – durch ein kurzes Training gefördert werden kann. Dazu erhielt im Chemieunterricht der 12. Klasse die Hälfte der ca. 900 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Anfang der Unterrichtsreihe ein Training zur Konstruktion kritischer Fragen: Dafür geschulte Lehrkräfte stellten Fallbeispiele vor und leiteten eine Übungsphase zur Anwendung an. Die Förderung folgte also dem Ansatz (4) und kombinierte anwendungsnahe In struk tion und dialogbasiertes Lernen. Der andere Teil der Schülerinnen und Schüler erhielt kein zusätzliches Training, aber den gleichen Unterricht. Am Ende der Unterrichtsreihe sollten die Schülerinnen und Schüler beider Gruppen bereitgestellte Informationen kritisch hinterfragen und ihre Fragen zum Ausgangspunkt eigener Recherchen machen. In Interviews sowie mithilfe von Fragebogentests zeigte sich, dass das Training sehr effektiv war für die Fähigkeit, kritisch zu denken und komplexe, kritische Fragen zu stellen und zu bearbeiten.
Fazit für die Unterrichtspraxis
Kritisches Denken kann im Unterricht aktiv gefördert werden – nicht nur in Form von kognitivem Handwerkszeug, sondern in gewissem Maße auch als kritische Grundhaltung. Wie das im Unterricht aussehen kann, dazu gibt es gerade für den MINT-Unterricht ein breites Spektrum an Erfolg versprechenden Möglichkeiten: angefangen von (angeleiteten) Diskussionen im Klassenverband bis hin zu Rollenspielen; von expliziter Vermittlung allgemeiner Prinzipien des kritischen Denkens bis hin zu enger Verzahnung mit spezifischen fachlichen Inhalten. Kritisches Denken zu fördern, kann also auf verschiedene Weise gelingen: nämlich dann, wenn Lehrkräfte es zu einem expliziten Unterrichtsziel erklären und die Aktivitäten im Klassenzimmer entsprechend darauf ausrichten.
Dr. Andreas Hetmanek, Annika Schneeweiss