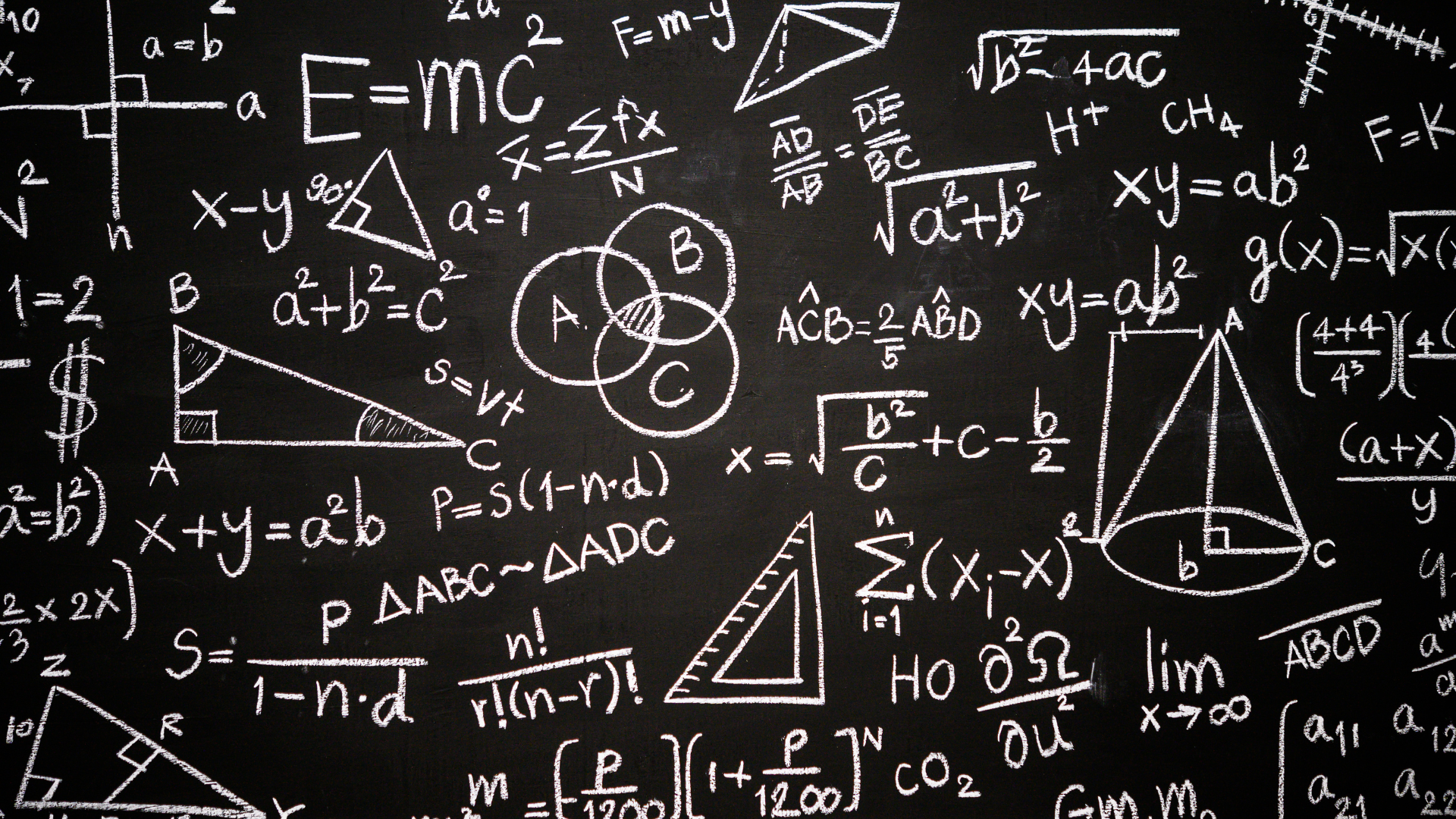Vor gut zehn Jahren kam es zum fulminanten Knall zwischen den USA und Russland: In einer Höhe von 800 Kilometern rasten der amerikanische Kommunikations satellit Iridium 33 und der russische Aufklärungssatellit Kosmos 2251 ineinander. Ihre Aufprallgeschwindigkeit lag bei fast zwölf Kilometern. Pro Sekunde. Mit der Wucht von ungefähr zehn Tonnen TNT sprengte es die beiden Satelliten in 100.000 kleine Teilchen. Weil die Erdanziehung zu schwach war, stürzten die Trümmerstücke nicht in die Atmosphäre und verglühten, sondern kreisen seitdem um die Erde.
Unser Weltraum wird zunehmend zu einer gigantischen Müllkippe; rund 200 Kollisionen und Explosionen hat es seit 1957, dem Start des ersten Satelliten ins All, gegeben, und das sind nur die Zusammenstöße, die klar nachgewiesen werden konnten. Im Orbit kreisen aktuell mehr als 170 Millionen Partikel, die größer sind als ein Millimeter und über 750.000 Schrott teilchen mit einer Größe zwischen ein und zehn Zentimetern. Dieser Weltraumschrott ist hoch gefährlich. Denn mit einer Geschwindigkeit von mehreren 10.000 Kilometern pro Stunde wird aus einem winzigen Partikel ein wahres Geschoss: Seine Wirkung gleicht einer Gewehrkugel. „Wenn eine Aluminiumkugel von gerade mal einem Zentimeter Durchmesser auf einen Satelliten trifft, hat sie die Energie eines Mittel klasse wagens, der mit etwa fünfzig Stundenkilometern in ihn hineinfährt“, erläutert Heiner Klinkrad, Chef für Weltraumtrümmer bei der European Space Agency, kurz ESA.
Und genau in dieser zerstörerischen Kraft liegt eine Gefahr, nicht nur für die Weltraumfahrt, sondern auch für die Satelliten. Etwa 18.000 solcher Teile hat man derzeit sicher im Visier, und wenn die Gefahr eines Zusammenstoßes zu groß ist, werden Satelliten oder die ISS von der Erde aus auf eine andere Bahn gelenkt.
Kessler-Syndrom – Gefahr für die Raumfahrt
Warum stürzen die Trümmerstücke nicht in die Atmosphäre und verglühen dort? Weil die Erdanziehung dafür zu schwach ist. Die Trümmerteile bleiben im All und kreisen und kreisen und kreisen. Und sie vermehren sich kontinuierlich, weil Schrott mit Schrott kollidiert. Über die Zeit entsteht um die Erde eine undurchdringliche Wolke an Weltraumschrott, das sogenannte Kessler- Syndrom, benannt nach dem US-Astrophysiker Donald Kessler, der schon 1978 vor den Gefahren des Weltraumschrotts warnte. In einigen Jahrzehnten könnte der Schrottgürtel dafür sorgen, dass wir die Raumfahrt ganz aufgeben müssen, weil der Gürtel aus rasend schnell fliegenden Teilchen undurchdringlich ist und die Teilchen Raumschiffe wie Schrapnelle durchlöchern. In einigen Flughöhen laufe das Kessler-Syndrom bereits ab, heißt es unter Experten der ESA. Aber die Warnungen werden wenig gehört.
Wie lösen wir das Problem des Weltraumschrotts? Über diese Frage konferiert die ESA mittlerweile jährlich. „Wir müssen das Problem auf zwei Arten angehen. Die erste: Wir hören auf, den Weltraum vollzumüllen. Die zweite: Wir müssen den vorhandenen Schrott entfernen“, sagt Lisa Innocenti vom Clean Space Programm der ESA.
Das All als Wertstoffhof: Die heutige Satelliteninfrastruktur hat einen schier unermesslichen Wert. Die Wiederbeschaffungskosten der circa 1.000 aktiven Satelliten in der Erdumlaufbahn werden auf eine Höhe von knapp 100 Milliarden Euro geschätzt.
Mit Robotern und Netzen gegen 8.000 Tonnen Schrott
Nachdem das Problem lange ignoriert wurde, forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in aller Welt an Lösungen, wie mit dem Schrott umgegangen werden kann. Darunter ist zum Beispiel die Idee eines Roboterarms, der außer Kontrolle geratene Satelliten einfangen könnte, damit sie keine Gefahr mehr darstellen. Der Arm könnte den kaputten Satelliten zur Erde leiten, wo er beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht. Oder im Südpazifik landet. Dort gibt es nämlich mittlerweile eine ausgewiesene Zone für Weltraumschrott.
Aber auch simpel anmutende Verfahren könnten sich eignen. Zum Beispiel, große Teile mit einem gigantischen Netz einzufangen und abzutransportieren. Pläne für Missionen zum Aufräumen von Weltraumschrott gibt es inzwischen viele. Mal soll der Schrott mit Magneten eingesammelt, mal mit Laserkanonen entsorgt werden. Nur gemacht hat es bisher niemand. Das ändert sich nun – zumindest virtuell.
Planetarium zum Mitmachen
In der interaktiven Lernshow Kinetarium, die in Kooperation mit dem Stuttgarter Planetarium entwickelt wurde, bekommen Schülerinnen und Schüler das Kessler-Syndrom erklärt und erleben das Phänomen interaktiv. Beim gemeinsamen virtuellen Weltraum- Putzen kann jeder Teilnehmende seine Rakete wahlweise mit einem Netz oder einem Magneten ausstatten und so die umherirrenden Schrottteile einfangen bzw. durch das Umlenken ihrer Flugbahn zum Abstürzen und Verglühen bringen. Das Ganze ist ein Multiplayerspiel mit bis zu 300 Spielern auf einem Screen – oder besser unter einer Kuppel. Dahinter steckt eine Kombination aus mobiler Web-App (der Controller) und Spiele-Engine, gekoppelt mit der digitalen Fulldome-Projektion des Planetariums. Die so entstandene Anwendung erlaubt es, die Steuerbewegungen der Teilnehmenden in live projizierte Bilder zu übersetzen.
Spannend finden die Entwickler dabei auch den Schwarmgedanken: „Unser Mechanismus macht Kooperation möglich. Das Verhalten der Menschen im Raum hat direkten Einfluss auf das Geschehen in der Kuppel. Aus den Zuschauern werden Akteure.“ So wird durch ein smart inszeniertes Multiplayer-Erlebnis ein wissenschaftliches Phänomen unterhaltsam und leicht nachvollziehbar aufbereitet.
Sebastian König
Weltraummüll in Zahlen:
Raketenstarts seit 1957: rund 5.250
Ins All beförderte Satelliten: rund 7.500
Derzeit im All befindliche Satelliten: rund 4.300
Noch funktionierende Satelliten: 1.200
Objekte größer als 10 cm: 29.000
Objekte zwischen 1 und 10 cm: 750.000
Objekte zwischen 1 und 10 mm: 166.000.000
Gesamtmasse des Weltraummülls: 7.500 Tonnen
(Quelle: ESA)
Weitere Informationen:
Das interaktive Wissensformat Kinetarium ist seit Mai 2019 im Planetarium Stuttgart erlebbar. Informationen und Termine unter: www.kinetarium.com