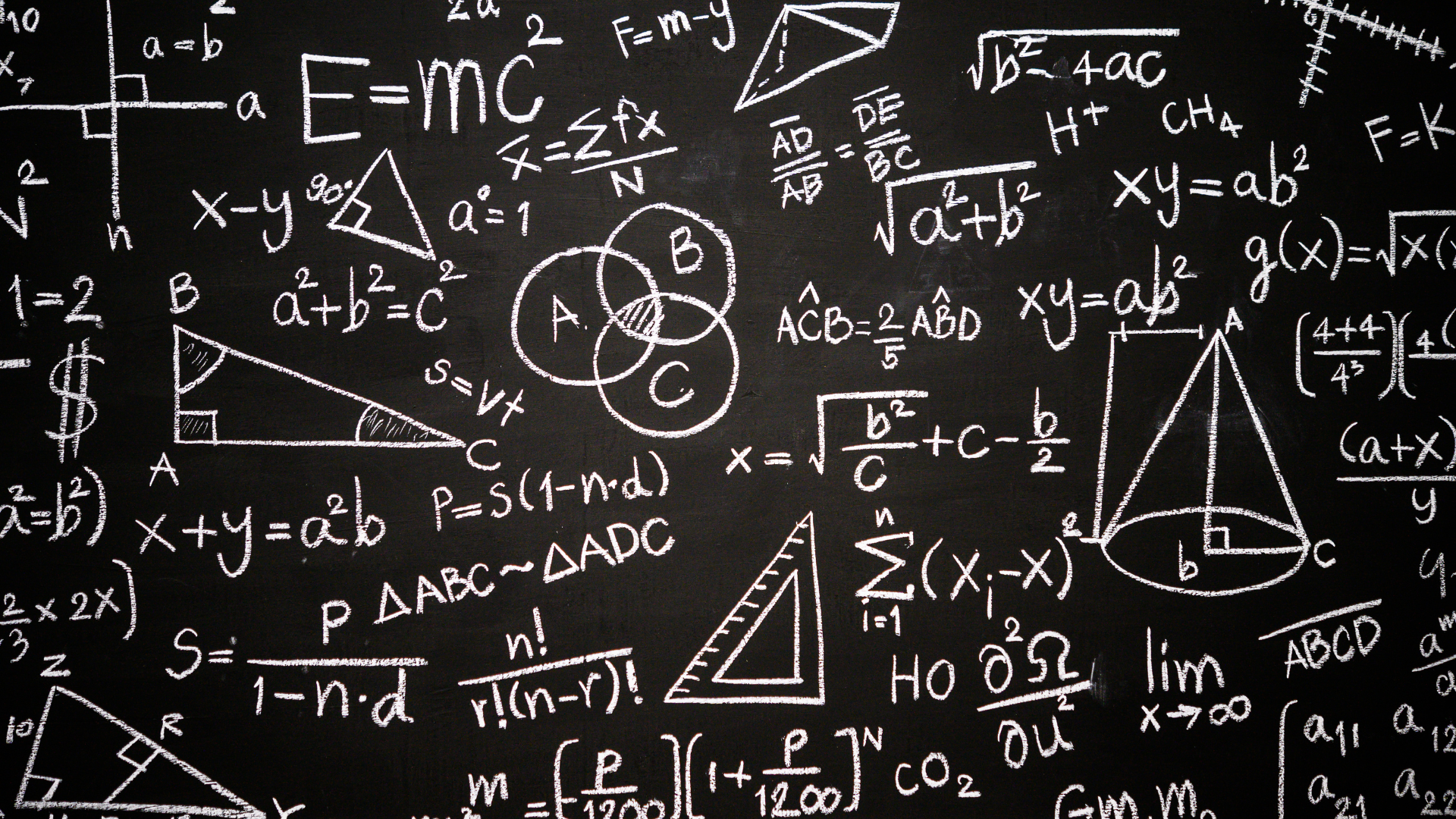Beim Selbstregulierten Lernen gestalten Schülerinnen und Schüler ihre Lernprozesse aktiv und eigenverantwortlich. Sie setzen sich eigene Ziele, planen, organisieren und evaluieren ihren Lernprozess. Die Unterrichtsforschung nimmt seit langem an, dass Selbstreguliertes Lernen zu besseren Lernerfolgen führt – auch in den MINT-Fächern. Zwei aktuelle Forschungssynthesen widmen sich der Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Selbstreguliertem Lernen und Lernerfolg gibt und wie Lehrkräfte Selbstreguliertes Lernen erfolgreich unterrichten können.
Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse 11 sollen sich Wissen zum Thema Photosynthese aneignen. Dazu stehen ihnen Texte und Grafiken zur Verfügung. Bevor Marc mit der Aufgabe beginnt, stellt er einen Zeitplan auf und legt fest, wie er sich die relevanten Informationen aus dem Text erschließen will – vom Bündeln der Informationen in Concept Maps oder Grafiken bis hin zur Textzusammenfassung hat sein Lehrer Herr Schröder ihnen verschiedene Möglichkeiten gezeigt. Nun setzt Marc die gewählten Strategien ein und gleicht seine Fortschritte und Ergebnisse immer wieder mit den gesetzten Zielen ab. Kommt er nicht weiter, bittet er Mitschülerinnen und Mitschüler oder seinen Lehrer um Unterstützung oder recherchiert im Internet. Am Ende der Lerneinheit bekommt er von Herrn Schröder Rückmeldung zu seinem Lernfortschritt und reflektiert die Ergebnisse und den Lernprozess: Hat er seine Lernziele erreicht? Und falls nicht, hätte er sich andere Ziele setzen sollen oder wären andere Lernstrategien zielführender gewesen?
Metakognitive Strategien
Diesem stark vereinfachten Beispiel liegt ein weit verbreitetes Modell des Selbstregulierten Lernens zugrunde, das Campillo und Zimmermann 2002 entwickelt haben. Darin unterteilen sie die metakognitiven Strategien des Selbstregulierten Lernens in drei Phasen:
- Planen,
- Bearbeiten von Aufgaben und
- Selbstreflexion.
Metakognitive Strategien steuern und kontrollieren den übergeordneten Lernprozess und den Einsatz von spezifischen Strategien. Diese kognitiven Strategien wiederum sind Werkzeuge, die Schülerinnen und Schüler einsetzen können, um sich den Lernstoff zu erschließen, zum Beispiel indem sie
- die Informationen auf das Wesentliche reduzieren,
- neu zusammenfassen oder
- mit bereits Gelerntem verknüpfen.
Andere Modelle integrieren zudem noch sogenannte Managementstrategien. Dazu gehört:
- mit anderen zusammen zu arbeiten oder
- sich eine optimale Lernumgebung zu schaffen.
Wie hängen Selbstreguliertes Lernen und Lernerfolg zusammen?
Dent & Koenka (2016) untersuchen in einer Metaanalyse, welchen Zusammenhang es zwischen metakognitiven und kognitiven Strategien des Selbstreguliertem Lernens und der Lernleistung von Schülerinnen und Schülern gibt und welche Faktoren diesen Zusammenhang beeinflussen.
Sie finden heraus, dass es kleine, aber signifikante Zusammenhänge gibt – sie sind am Größten in den Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften und bei älteren Schülerinnen und Schülern von der Mittelstufe aufwärts. Das bedeutet: Lernende, die ihr Lernverhalten aktiv steuern, können mit besseren Schulleistungen rechnen. Der größte Zusammenhang im Hinblick auf metakognitive Strategien besteht zwischen Planen und Lernerfolg. Wenn Schülerinnen und Schüler also die einzelnen Lernschritte gut vorbereiten und in eine sinnvolle Reihenfolge bringen, ist zu erwarten, dass ihr Lernerfolg steigt. Bestimmte kognitive Strategien, die helfen, Informationen besser und tiefergehender zu verarbeiten – wie das Herausarbeiten zentraler Ideen eines Textes – wirken sich sehr viel positiver auf den Lernerfolg aus als oberflächliche kognitive Strategien wie Auswendiglernen. Letztere können sogar kontraproduktiv sein. Die Metaanalyse zeigt, dass es nicht nur wichtig ist, wie häufig Lernende metakognitive und kognitive Strategien einsetzen (Quantität), sondern vor allem auch, um welche Strategien es sich handelt und wie sie eingesetzt werden (Qualität).
Selbstreguliertes Lernen unterrichten – wie geht das?
Welche Erkenntnisse können Lehrkräfte daraus für ihren Unterricht ziehen? Wie können sie Schülerinnen und Schüler bestmöglich zum Selbstregulierten Lernen anleiten? Damit befasst sich eine weitere Metaanalyse von Donker und Kollegen (2014). Die Autoren nehmen an, dass sich Interventionen, die das Selbstregulierte Lernen fördern, indirekt immer auch positiv auf den Lernerfolg auswirken. Um das zu überprüfen, untersuchen sie empirisch, wie sich die Instruktion von kognitiven, metakognitiven und Management-Strategien auf die Lernleistung auswirkt.
Die Ergebnisse der Metaanalyse sind vielversprechend für Lehrkräfte – denn sie zeigen nicht nur, dass sich Selbstreguliertes Lernen positiv auf den Lernerfolg auswirkt, sondern auch, dass es möglich ist, Selbstreguliertes Lernen zu unterrichten. Am größten ist der Effekt im Bereich Schreibkompetenzen, gefolgt von Naturwissenschaften und Mathematik. Die Analyse zeigt zudem, dass alle Lernenden unabhängig von sozioökonomischen Hintergrund, Alter, Migrationshintergrund oder Leistungsprofil vom Unterrichten des Selbstregulierten Lernens profitieren. Da sich einerseits alle getesteten Strategien als wirksam erweisen, sich aber andererseits bestimmte Strategien je nach Kontextbedingung besser eignen, sollten Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern sowohl eine Vielzahl an Strategien als auch metakognitives Wissen über Selbstreguliertes Lernen vermitteln. Denn dann können sie selbst entscheiden, welche Strategien wann für sie geeignet sind.
Selbstreguliertes Lernen modellhaft unterrichten
Eine Einzelstudie aus der Metaanalyse illustriert, wie Selbstreguliertes Lernen konkret unterrichtet werden kann: Darin wandten Lehrkräfte Strategien modellhaft an und erklärten ihren Schülerinnen und Schülern anschließend, wann, wie und warum sie die Strategien jeweils einsetzten. Auf diese Weise vermittelten sie zusätzlich metakognitives Wissen über Selbstreguliertes Lernen. Wenn Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schülern außerdem noch individuelles Feedback zum Selbstregulierten Lernen geben – zum Beispiel Informationen über persönliche Lernstile, Stärken und Schwächen – können Lernende neben allgemeinem metakognitivem Wissen auch ihr persönliches Wissen über das eigene Lernverhalten erweitern.
Fazit
Letztlich empfiehlt es sich, so früh wie möglich mit der Instruktion von Selbstreguliertem Lernen zu beginnen. Denn durch einen frühen Start und mit einer langfristigen, breit angelegten Anleitung zum Selbstregulierten Lernen profitieren Lernende am meisten.
Dr. Anne Wiesbeck, Annika Schneeweiss
Weitere Informationen
Das Clearing House Unterricht wurde 2015 an der TU München gegründet und wird im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom Ministerium für Bildung und Forschung gefördert. Ziel des Projekts ist es, die aktuell beste und verfügbare wissenschaftliche Evidenz zu Themen des MINT-Unterrichts für die Lehrerbildung aufzubereiten.
Links
Kurzreviews zum Selbstregulierten Lernen
Selbstreguliertes Lernen und Lernerfolg bei SchülerInnen: Gibt es einen Zusammenhang?
Selbstreguliertes Lernen unterrichten: Eine Möglichkeit, den Lernerfolg zu fördern?
Die Kurzreviews enthalten jeweils einen tabellarischen Überblick über alle getesteten Strategien und deren Wirksamkeit.