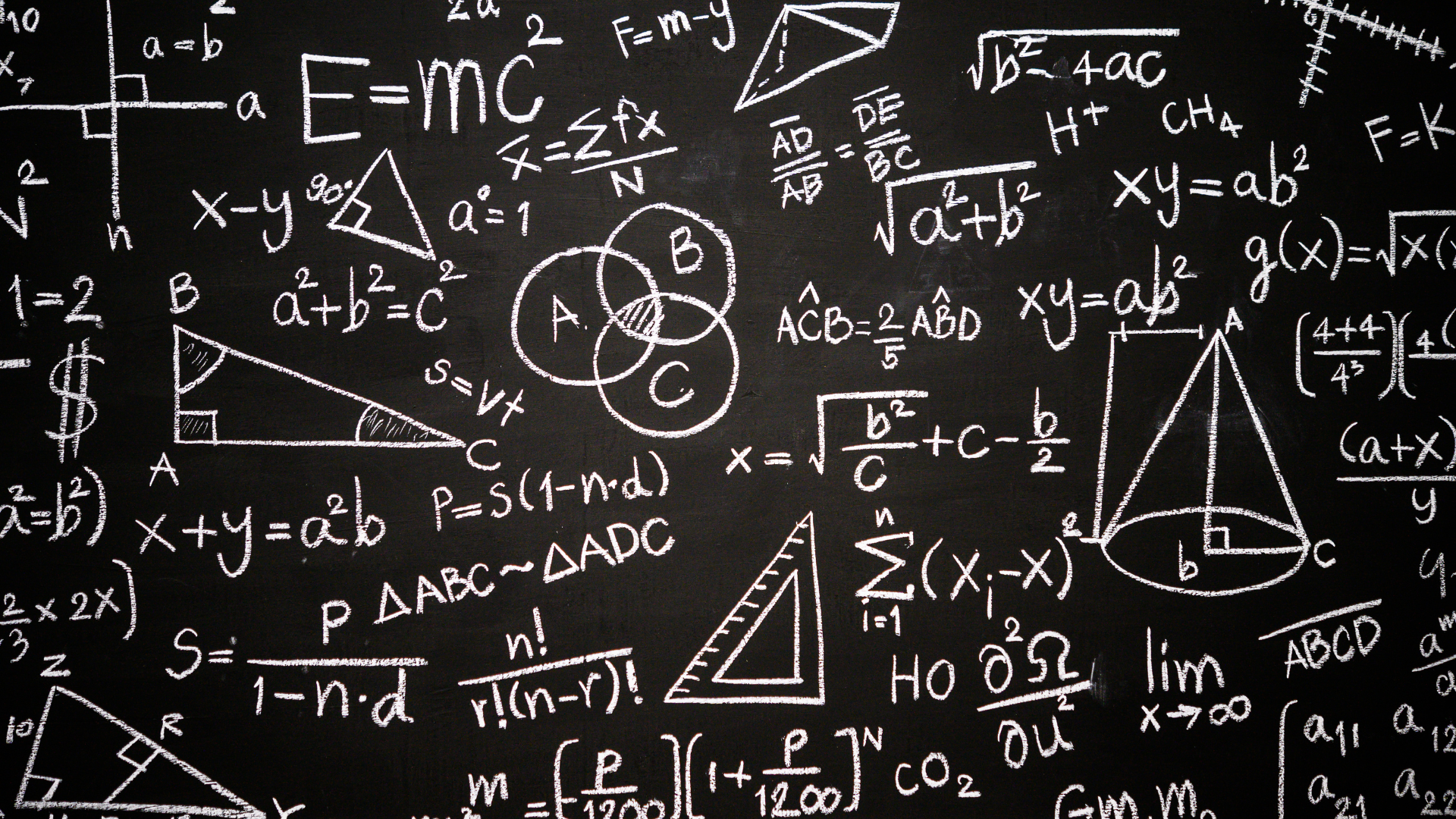Schülerinnen und Schüler sollen im Unterricht lernen wie Wissenschaftler zu denken und zu experimentieren – so steht es in den Bildungsplänen. Doch wie kann das konkret aussehen? Der Freiburger Physikdidaktiker Martin Schwichow hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen untersucht, wie sich wissenschaftliches Denken im MINT-Unterricht fördern lässt. Dabei nehmen sie eine konkrete Methode in den Blick – die Variablenkontrollstrategie.
Zwei Pflanzen wachsen unter identischen Bedingungen: Sie haben die gleiche Erde, die gleiche Menge an Licht und denselben Dünger zur Verfügung. Nur die Menge an Wasser, die sie bekommen, unterscheidet sich. Wächst nun eine Pflanze schneller als die andere, hängt das mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der unterschiedlichen Wassermenge zusammen. Bei diesem Versuch handelt es sich um ein sogenanntes kontrolliertes Experiment: Dabei werden möglichst alle Variablen kontrolliert, das heißt konstant gehalten. Nur die Variable Wasser wird variiert.
Mit dieser experimentellen Strategie lassen sich plausible Ursache-Wirkungszusammenhänge feststellen und belegen – sie wird Variablenkontrollstrategie (VKS) genannt. Ziel ist es, systematisch alle infrage kommenden Erklärungen für ein Phänomen nacheinander auszuschließen, bis nur noch nachweislich kausale Erklärungen übrig bleiben.
Relevanz für den MINT-Unterricht
Die Variablenkontrollstrategie rückt im Zusammenhang mit der stärkeren Betonung von forschungsbezogenen Kompetenzen in Bildungsstandards und Lehrplänen zunehmend als Unterrichtsziel der MINT-Fächer in den Fokus. Dabei geht es nicht nur darum, dass Schülerinnen und Schüler kausale Nachweise mithilfe von Experimenten selbst erzeugen können, sondern auch, dass sie durch das Verständnis wissenschaftlicher Strategien lernen, angebotene Erklärungen zu hinterfragen und auf der Basis wissenschaftlich gewonnener Erkenntnisse zu argumentieren. In ihrer Metaanalyse haben Schwichow und seine Kolleginnen und Kollegen eine Vielzahl an Studien zu der Frage ausgewertet, wie die Variablenkontrollstrategie besonders effektiv unterrichtet werden kann. Sie kommen dabei zu teilweise überraschenden Ergebnissen.
Demonstrationen helfen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren
Häufig wird angenommen, dass es für Schülerinnen und Schüler wichtig sei, im Unterricht selbst experimentieren zu können. Die Metaanalyse stellte jedoch fest, dass das eigenständige Experimentieren keinen besonderen Nutzen hat, wenn es darum geht, die Variablenkontrollstrategie zu unterrichten. Sind Schülerinnen und Schüler allzu sehr mit Versuchsaufbauten beschäftigt, binden technische und handwerkliche Details viel Aufmerksamkeit und lenken vom Kern – der experimentellen Strategie der Variablenkontrolle – eher ab.
Zu dieser Erklärung passt auch der Befund, dass es für Schülerinnen und Schüler lernförderlich ist, wenn ihnen Experimente demonstriert werden, um die Variablenkontrollstrategie grundlegend zu erlernen. So können sie sich ganz auf die jeweiligen Merkmale des Experiments und das strategische Vorgehen konzentrieren.
Kognitive Konflikte ermöglichen tieferes Verständnis
Interessant ist auch ein weiterer Befund: Es wirkt sich positiv auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern aus, wenn sie einen sogenannten kognitiven Konflikt erleben. Er wird dann ausgelöst, wenn Lernende mit dem Ergebnis eines Experiments konfrontiert werden, das nicht mit den eigenen Erwartungen oder Überzeugungen übereinstimmt. Solche Brüche zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Ergebnis können ein grundlegendes Verständnis der experimentellen Strategie bewirken, wenn Schülerinnen und Schüler dazu angeleitet werden, den Ursachen für die Diskrepanz auf den Grund zu gehen.
Der Lernerfolg lässt sich steigern, wenn Demonstrationen und kognitive Konflikte miteinander kombiniert werden: Lehrkräfte können beim Vorführen eines Experiments kognitive Konflikte gezielt provozieren, indem sie bewusst Fehler in die Umsetzung der experimentellen Strategie einbauen.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Eine Physiklehrerin hat einen Eisenball und einen Tischtennisball jeweils in einer Hand. Sie fragt die Klasse, welcher Ball höher springt. Die Schülerinnen und Schüler sagen voraus, dass der Tischtennisball höher springt. Bei der Demonstration springt der Eisenball jedoch höher. Die Lehrerin hat die Bälle aus unterschiedlicher Höhe und auf verschiedene Oberflächen fallen lassen. Sie hat mehrere Variablen zugleich variiert. Die Diskrepanz zwischen Vorhersage und den Ergebnissen aufgrund des „unfair“ durchgeführten Experiments bewirkt den kognitiven Konflikt. Bei der anschließenden Diskussion in der Klasse gilt es zunächst, Ursachen für die unerwartete Beobachtung zu festzustellen. Danach diskutieren die Schülerinnen und Schüler, wie der Test in ein „faires“ bzw. kontrolliertes Experiment umgewandelt werden könnte. Durch diese Art der Auseinandersetzung gewinnen sie ein tieferes Verständnis von experimentell kontrollierten Vergleichen und lernen, warum es so bedeutsam ist, möglichst alle Variablen bis auf eine, deren Auswirkung untersucht werden soll, zu kontrollieren.
Fazit für die Unterrichtspraxis
Wie die Metaanalyse zeigt, hat die Variablenkontrollstrategie konkrete Relevanz für den MINT-Unterricht. Es lohnt sich, Experimente so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler sich auf die Kernelemente des experimentellen Vorgehens fokussieren können. Dies gelingt, wenn Lehrkräfte Experimente demonstrieren, die idealerweise so gestaltet sind, dass sie einen kognitiven Konflikt erzeugen.
Dr. Andreas Hetmanek,
Annika Schneeweiss
Weitere Informationen
Das Clearing House Unterricht wurde 2015 an der TU München gegründet und wird im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom Ministerium für Bildung und Forschung gefördert. Ziel des Projekts ist es, die aktuell beste und verfügbare wissenschaftliche Evidenz zu Themen des MINT-Unterrichts für die Lehrerbildung aufzubereiten.
Links
Kurzreview des Forschungsergebnisses
Weitere Forschungsbefunde und Unterrichtsmaterialien zu Variablenkontrollstrategie: www.scientific-reasoning.com