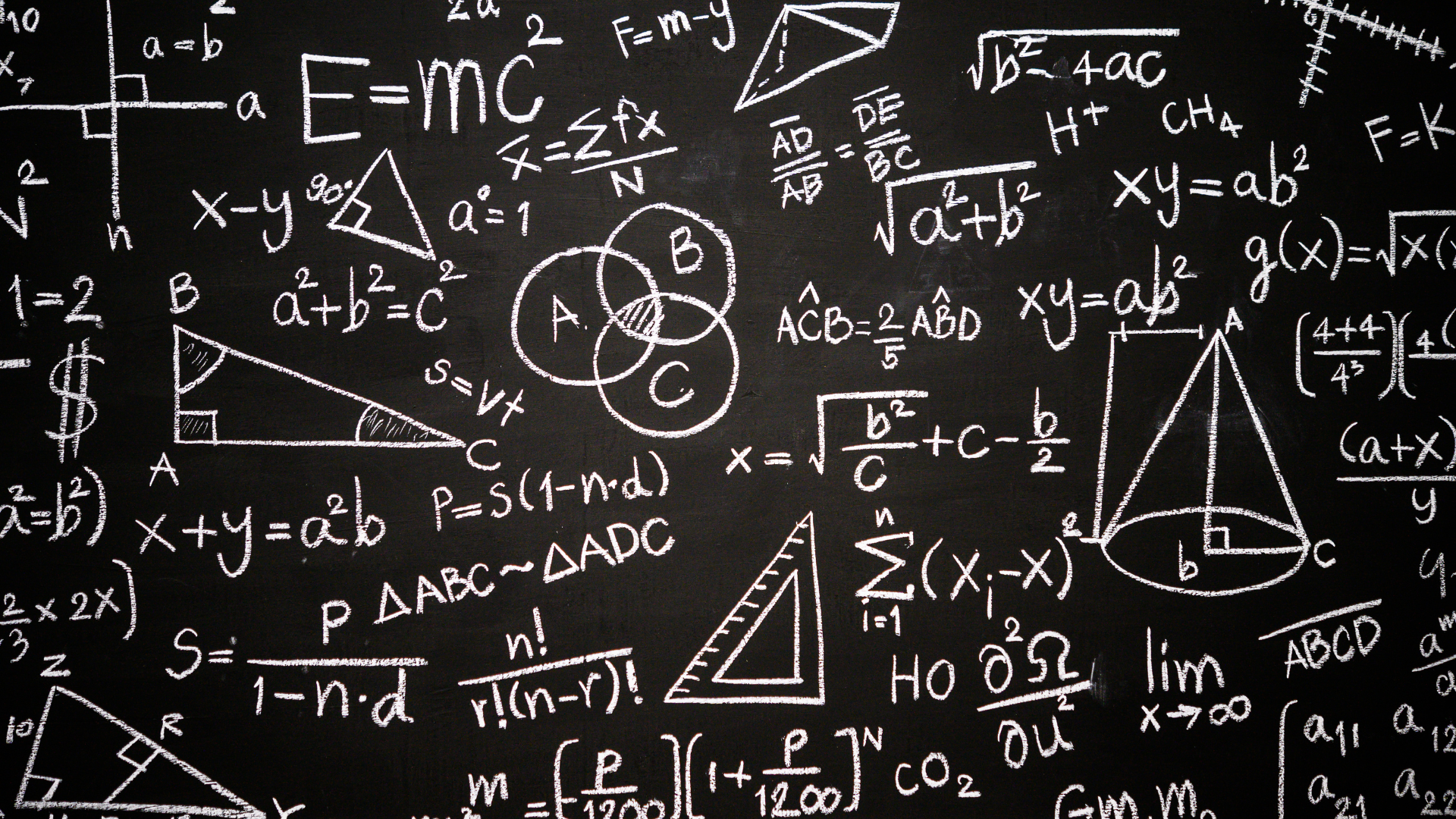Die Welt begreifen, das kann man ruhig wörtlich nehmen. Endlich einmal offene Fragen klären: Wie weit weg ist der Horizont? Woher weiß man, wie hoch der Mount Everest ist? Muss wirklich irgendwer Dreiecke berechnen können?
Seit vielen Jahren wird in der fünften Schulwoche in der Klasse 10 des Chemnitzer Schulmodells ein fächerübergreifendes Projekt in Anlehnung an Daniel Kehlmanns Buch „Die Vermessung der Welt“ durchgeführt. Höhepunkt der Projektwoche ist eine dreitägige Exkursion nach Pritschroda/Thüringen. Die Betreuung jeder Klasse erfolgt durch zwei Lehrkräfte und zwei Studierende. Neben der Lektüre des Romans wird sich in den Fächern gezielt auf die Exkursion vorbereitet. Folgende Geräte werden zudem benötigt: vier Sätze Theodoliten (inkl. Nivellierlatten, Bandmaße und Stativfüße), ein Bohrstock (Pürckhauer) sowie einen zum Bohrstock passenden Hammer und Klappspaten.
Vorbereitung und Ziele Mathematik
Im Mathematikunterricht wird vorab die Dreiecksberechnung aus der Klasse 9 fortgesetzt, sodass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Kosinus- und Sinussatz alle ebenen Dreiecke berechnen können. Angelehnt an den Lehrplan der Oberschule Sachsens geht es vor allem darum, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, bei der Lösung von Problemen geeignete grafische und rechnerische Verfahren begründet auszuwählen. Ziel der Exkursion ist es, dass sie auch unter Nutzung heuristischer Strategien Lösungswege planen und diese vor allem auch realisieren.
Die Vermessung der Welt bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, beim Lösen dieser komplexeren Anwendungsaufgaben die Erfahrungen aus ihrem Lebensumfeld zum Verknüpfen von mathematischen Inhalten direkt anzuwenden. Sie nutzen für trigonometrische Berechnungen den Sinus- und den Kosinussatz und lernen so das Anwenden trigonometrischer Beziehungen auf vielfältige Sachverhalte wie dem Berechnen von Längen, Winkelgrößen und Flächeninhalten in beliebigen Dreiecken und Vielecken. Bevor es auf Exkursion geht, werden die Schülerinnen und Schüler zudem auf dem Schulhof mit dem Theodoliten vertraut gemacht.
Der Unterricht in den Fächern Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte und Physik ist am Chemnitzer Schulmodell epochal organisiert. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben in einer Woche acht Stunden in nur einem dieser Fächer. In den Fächern Geografie und Geschichte sind die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen aufgeteilt. In der Woche vor der Exkursion findet dann eine Geografie-/Geschichtsepoche statt.
Vorbereitung und Ziele in den Fächern Geografie und Geschichte
Im Fach Geografie bestehen die Hauptziele darin, dass die Schülerinnen und Schüler Raumstrukturen und -prozesse erkennen. Durch das Vermessen der Welt vertiefen und systematisieren sie ihr Wissen über Landschaften und Elementarstrukturen des Wirtschafts- und Sozialraums. Sie entwickeln raumbezogene Handlungskompetenzen in der Begegnung mit dem Heimatraum und werden so für Möglichkeiten der Mitwirkung bei seiner Gestaltung sensibilisiert. Folgende Aufgaben dienen zur Vorbereitung:
- Stelle das Bundesland Sachsen in wichtigen Merkmalen vor, vergleiche es mit Thüringen und gib als Vergleichsgröße auch die Werte von Deutschland mit an (Fläche, Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte, Hauptstadt, drei höchste Berge, drei längste Flüsse, drei größte Städte)! Bitte notiere unbedingt die Quellenangaben sowie die notwendigen Jahreszahlen.
- Fertige eine handgezeichnete Lageskizze an, wie wir von Chemnitz Hbf. nach Freienorla fahren. Trage ein und benenne die größeren Orte, Flüsse, Landschaften, die wir durchfahren und norde die Lageskizze ein.
- Gib eine Bodendefinition an. Wie entsteht Boden? Welche bodenbildenden Faktoren gibt es? Zeichne ein ideales Bodenprofil und bezeichne die Horizonte.
Im Fach Geschichte werden Vorträge vorbereitet, die während der Exkursion abends am Lagerfeuer gehalten werden. Angelehnt an den Lehrplan Geschichte ist das Ziel der Exkursion, dass die Schülerinnen und Schüler Verständnis für zeittypische Bedingungen und Veränderungsprozesse in Vergangenheit und Gegenwart entwickeln und erkennen, dass es Wechselwirkungen zwischen historischen Entwicklungen, Ereignissen und Erfahrungen gibt. Der geschichtliche Rahmen für das Projekt umfasst die Lebenszeit von Alexander von Humboldt (1769–1859). Die Vorträge thematisieren sein Leben, seine Reisen nach Süd- und Mittelamerika und Russland, sowie die Biographien von Aimé Bonpland, Carl Friedrich Gauß und Sophie Germain.
Das Vermessen und Erforschen beginnt – die Exkursion
Am Ankunftstag werden zunächst die Zelte aufgebaut, die Küche wird inspiziert, Holz wird gesammelt, denn die Vorträge der Geschichtsgruppe werden am Lagerfeuer gehalten. Die Messgeräte werden ausprobiert und die Schülerinnen und Schüler machen sich mit den Studenten der Geo-Werkstatt Leipzig bekannt, die am nächsten Tag die große Exkursion begleiten werden.
Nach dem Frühstück geht es am zweiten Tag los. Mit dem Bohrstock wird die erste Bodenprobe entnommen. Die ersten Fachbegriffe wie Bodenhorizont, Sand, Löß und Verwitterung werden in das Protokoll übernommen. Die im Unterricht gelernten Begriffe werden so anschaulich und fassbar.
Dann weiter zur nächsten Station: einem trigonometrischen Punkt. Er ist aus mathematischer Sicht interessant, auch der Vortrag vom Vorabend über Gauß und dessen Vermessung des Königreiches Hannover wird in Erinnerung gerufen. Darüber hinaus sind hier auch etliche Schichtstufen des Saaletals erkennbar. Weiter geht es von Station zu Station. Bodenprofile werden gezeichnet, Höhendaten – aus einer topografischen Karte – ermittelt, natürliche und menschliche Einflüsse (Kiesabbau, Köhlerplatz) erfasst. Noch sind weitere acht Stationen zu absolvieren. Es ist schon erstaunlich, es liegen gerade mal 200 Meter zwischen der zweiten und dritten Station, aber die Verwitterungsmerkmale und die Spuren des Grundwassers sind komplett anders. Kurze Rast an der wüsten Kirche im Würzbachgrund, dann kommt ein Bodenaufschluss, wo deutlich Spuren eines alten Köhlerplatzes zu Tage treten. Nach rund sechs Stunden ist die Expedition beendet. Nun gilt es, mittels Theodoliten die Entfernungen zweier Sendemasten und deren Höhe zu ermitteln. Messen, Rechnen und Überprüfen. Verflixt, wieso kommt da als Höhe fast 300 Meter raus, wenn die richtige Schätzung bei rund 35 Meter liegt. Die Fehlersuche ist nicht ganz einfach, aber machbar. Das im Unterricht schon benutzte Arbeitsblatt (s. Download) kommt hier immer wieder zum Einsatz.
Das am Vortag Gelernte wird am dritten Tag im Wolfstal direkt angewandt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen eigene Bodenprofile auf, vermessen die prozentuale Hangneigung und sammeln Zeigerpflanzen. Anschließend geht es dann zurück nach Chemnitz.
Fazit
Das in der Schule Gelernte hat seine Berechtigung im Alltag, auch wenn nicht jeder Landvermesser werden wird. Aber vor Ort können die Schülerinnen und Schüler immer wieder eine Antwort finden auf die Frage: „Wozu brauche ich das?“ Der Mathematikunterricht wird so wesentlich bereichert. Ausdauer und Genauigkeit beim selbstständigen Messen werden belohnt. Bilder und Zeichnungen aus dem Lehrbuch werden lebendig. Und immer mal wieder ein: „Jetzt verstehe ich das“. Auch die beteiligten Lehrkräfte sagen, ob vor Ort oder bei der Vor- und Nachbereitung, anschaulicher können Lehrpläne nicht umgesetzt werden. Da ist nichts wirklich Zusätzliches dabei, es ist ein anderer Lernort, ein Lernen vor Ort.
Thomas Jahre
www.schulmodell.eu