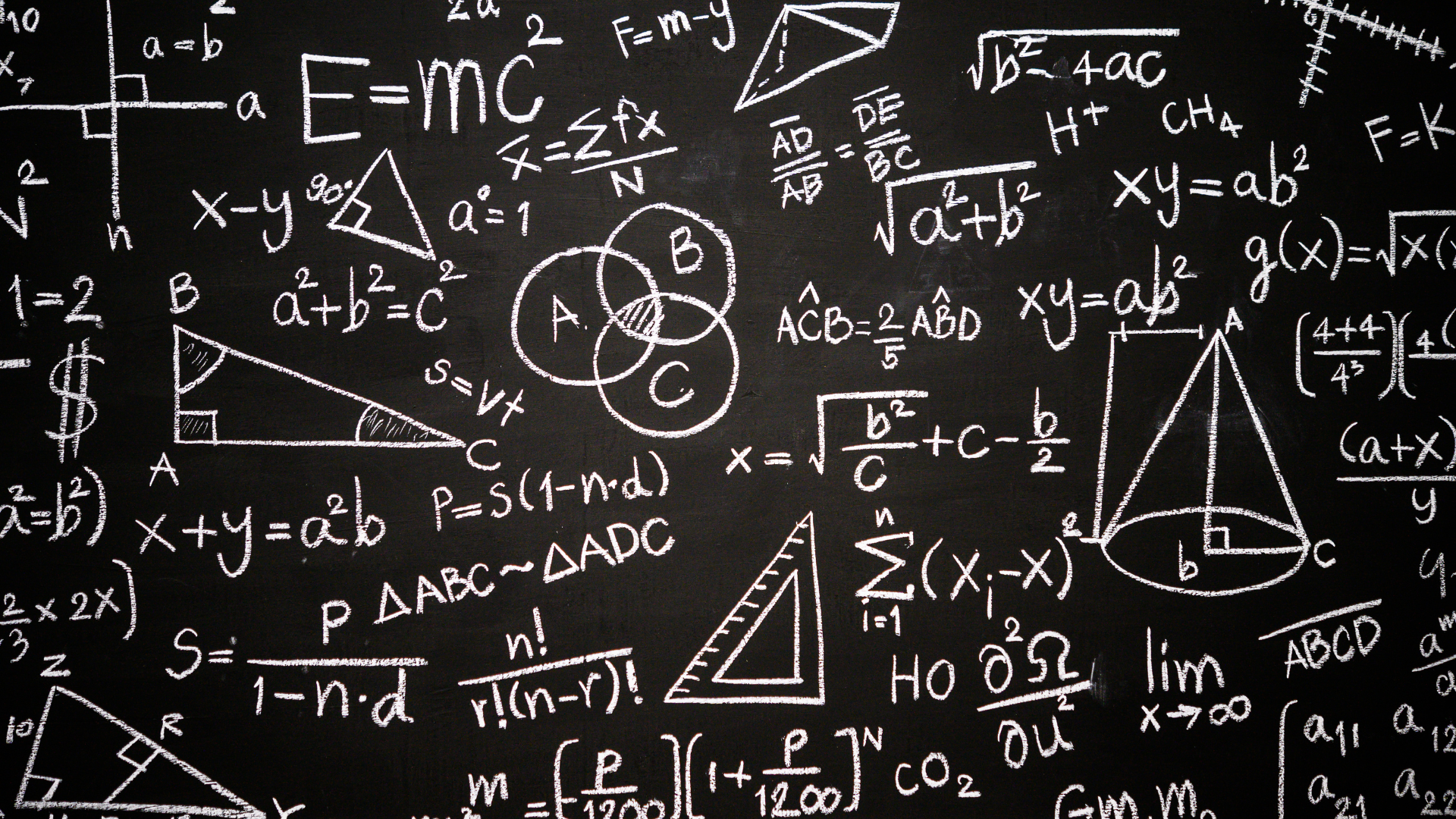Exkursionen sind als willkommene Abwechslung bei Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. Außerschulisches Lernen hat aber noch mehr Facetten. Vom Bauernhof über das Technikmuseum hin zum naturwissenschaftlichen Schülerlabor erschließt sich eine breite Palette an vielversprechenden Lernmöglichkeiten. Der Artikel gibt einen Überblick über Fachdidaktik und Schulpraxis.
Der Erfahrung nach begibt sich eine Klasse etwa ein- bis dreimal pro Schuljahr auf Exkursion. Außerschulisches Lernen ist damit an den meisten Schulen ein fester Bestandteil des Lernens.
Außerschulische Lernangebote im Blick der Forschung
Exkursionen führen die Lernenden an besondere Lernorte. Die fachdidaktische Forschung beschreibt solche „außerschulischen Lernorte“ schlicht als Lernumgebungen außerhalb der Schule (Mayer, 2013). Dabei werden didaktisch aufbereitete Lernorte (z. B. Museum, Zoo) von nicht aufbereiteten Lernorten (z. B. Wald) unterschieden. Mit Hilfe der Termini „formales Lernen“ (in der Schule), „non-formales Lernen“ (außerhalb der Schule, mit Lehrpersonal) und „informelles Lernen“ (außerschulisch, ohne Lehrpersonal) wird die Verknüpfung auch zur englischsprachigen Literatur hergestellt (Sefton-Green, 2012). Eine Abgrenzung zum normalen Schulunterricht kann also über den Ort des Lernens sowie anhand der Person oder der Institution, die das Lernen organisiert, erfolgen. Ein Beispiel für einen externen Anbieter von Lernprogrammen im Schulgebäude ist die Initiative junger Forscherinnen und Forscher (IJF, siehe Foto). Einige der Forschungsergebnisse zu außerschulischen Lernorten werden in den folgenden Abschnitten aufgegriffen.
Mögliche Lernorte
Welche Orte sind für außerschulisches Lernen besonders attraktiv? Eine Befragung von 554 Biologielehrkräften ergab, dass als außerschulische Lernorte am häufigsten Wald, Gewässer, Zoo, Naturkundemuseum und landwirtschaftliche Betriebe genutzt werden (Pohl, 2008). Die Vielfalt außerschulischer Lernorte ist aber weit größer. Möglich sind neben Lebensräumen (z. B. Wald, Wiese, Gewässer), die mitunter didaktisch gestaltete Bestandteile bereithalten können (z. B. Naturlehrpfad), auch Produktions- und Dienstleistungsbetriebe (z. B. Bauernhof, Kläranlage, Chemiebetrieb), Schülerlabore, Schülerforschungszentren, Forschungseinrichtungen sowie naturwissenschaftliche oder technische Sammlungen (z. B. Zoo, Museum). Schülerlabore erfuhren zwischen den Jahren 2001 und 2009 einen regelrechten Gründungsboom. Im Vordergrund dieser Angebote steht meist das eigenständige Experimentieren der Lernenden in einer Laborumgebung (Haupt et al., 2013).
Warum ist außerschulisches Lernen sinnvoll?
Für viele Inhalte des Lehrplans und des Unterrichts liegen die realen Bezüge außerhalb des Schulzimmers. Die Begegnung mit dem Original sowie die Einbettung in einen authentischen Kontext sind mitunter nur an außerschulischen Lernorten möglich, worin auch deren besondere Chance liegt. Nicht prinzipiell führt der Besuch eines außerschulischen Lernorts zu dem gewünschten Lernzuwachs (Groß, 2011). Generell zeigen sich aber positive Effekte auf Wissenserwerb und insbesondere auf motivationale Faktoren wie Interesse, Einstellungen und Werthaltungen (Bell et al., 2009; Rennie, 2007).
Zudem bietet außerschulisches Lernen sehr gute Möglichkeiten, fachtypische Arbeitsweisen besser nachvollziehen zu können, z. B. Freilandbeobachtungen von Tieren oder naturwissenschaftliches Experimentieren. Da außerschulischer Unterricht meist nicht an die räumliche und zeitliche Reglementierung im Klassenraum gebunden ist, ergeben sich auch besondere Chancen für selbstorganisiertes, handlungsorientiertes und soziales Lernen. Dies ist umso interessanter, weil so auch die geforderten Kompetenzbereiche Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung in den Fokus rücken.
Integration in den Unterricht
Entscheidend für einen fruchtbaren Lernprozess ist neben der Qualität der didaktischen Aufbereitung des außerschulischen Lernorts vor allem die Einbindung in den normalen Unterricht (Dillon et al., 2006). Im Rahmen der unterrichtlichen Vorbereitung sollte die Lehrkraft konkrete Lernziele für den Besuch des außerschulischen Lernorts festlegen. Eine Exkursion kann zusammen mit den Lernenden vorbereitet werden. Welche Vorstellungen von dem Lerninhalt haben wir vorab? Was wollen wir herausfinden und wie wollen wir dabei vorgehen? Wer macht was in welchen Gruppen? Besitzen die Schülerinnen und Schüler genaue Arbeitsaufträge mit einer eigenen Fragestellung, können sie oftmals weitgehend selbstständig den außerschulischen Lernort nutzen. Die Lehrkraft begleitet, moderiert und hilft bei Bedarf.
Während der unterrichtlichen Nachbereitung in der Schule werden die gewonnenen Ergebnisse ausgewertet und gesichert sowie mit vorhandenen Kenntnissen vernetzt. Abschließend wird die gesamte Unterrichtssequenz reflektiert. Eine Verbindung zwischen Schule und außerschulischem Lernen schaffen mitunter Wettbewerbe wie Jugend forscht (Paul et al., 2016), indem hierfür eigene Zusatzkurse an Schulen ins Leben gerufen werden.
Aus der Schulpraxis
Das größte Hindernis, außerschulische Lernorte zu nutzen, ist der damit verbundene Aufwand für die Lehrkraft und für die Schule. Notwendige Terminabsprachen, die zeitintensive Recherche zu den Rahmenbedingungen (z. B. Anfahrt, Kosten, Verpflegung, örtliche Betreuung oder Führung, Besuchsdauer, Größe der Lerngruppe, Lernmöglichkeiten, Ausstattung), der Unterrichtsausfall und eine thematische Eingrenzung aufgrund des Lehrplans und der lokalen Angebote erschweren das Aufsuchen eines außerschulischen Lernorts. Daher empfiehlt es sich unbedingt, eine einmal durchgeführte Exkursion, die sich bewährt hat, mehrfach zu wiederholen, ggf. zu optimieren und dauerhaft für eine bestimmte Jahrgangsstufe zu etablieren.
Auch wird die wichtige unterrichtliche Vor- und Nachbereitung für die Lehrkraft erleichtert, wenn das Ziel der Exkursion bereits gut bekannt ist. Werden dabei die wesentlichen inhaltlichen und organisatorischen Eckpunkte dokumentiert, können auch andere Lehrkräfte die gleiche Exkursion mit weit weniger Aufwand durchführen. So könnte ein schulweites fest verankertes Konzept entstehen, welche Jahrgangsstufe wann welchen außerschulischen Lernort aufsucht. Zumindest einer der beiden oft üblichen Wandertage kann zu einem Projektwandertag werden, an dem nur noch ein bestehendes stufenspezifisches Programm umgesetzt werden muss. Für jede Jahrgangsstufe könnte dabei ein bestimmtes Schulfach einen lehrplankonformen geeigneten außerschulischen Lernort auswählen. So bereitet eine Exkursion nicht bloß Aufwand für die Lehrkraft, sondern wird zu einer fruchtbaren Lernerfahrung mit bleibenden Eindrücken als integraler Bestandteil des Unterrichts.
Dr. Jürgen Paul, Universität Bamberg
Literatur
Bell, P., Lewenstein, B., Shouse, A. W., & Feder, M. A. (Eds.). (2009). Learning science in informal environments: People, places, and pursuits.
Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. & Benefiled, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-111.
Groß, J. (2011). Orte zum Lernen – Ein kritischer Blick auf außerschulische Lehr-/ Lernprozesse. In: Messmer, K., von Niederhäuser, R., Rempfler, A. & Wilhelm, M. (Hg.): Außerschulische Lernorte – Positionen aus Geographie, Geschichte und Naturwissenschaften. LIT Verlag Münster, Berlin, Wien, Zürich, 25-49.
Haupt, O., Domjahn, J., Martin, U., Skiebe-Corrette, P., Vorst, S., Zehren, W., & Hempelmann, R. (2013). Schülerlabor – Begriffsschärfung und Kategorisierung. MNU, 66(6), 324–330.
Mayer, J. (2013). Freiland, Umweltzentren und Schülerlabore. In: H. Gropengießer, U. Harms, U. Kattmann (Hg.), Fachdidaktik Biologie. Aulis Verlag, Hallbergmoos, S. 429–440.
Paul, J., Schanze, S. & Groß, J. (2016). Lernwege zum Experimentieren beim Wettbewerb Jugend forscht. CHEMKON 23(4): 170-180.
Pohl, C. (2008). Die Bedeutung außerschulischer Lernorte für den Biologieunterricht. Schüling Verlag, Münster.
Rennie, L. J. (2007). Learning science outside of school. Handbook of research on science education, 125-167.
Sefton-Green, J. (2012). Learning at not-school: A review of study, theory, and advocacy for education in non-formal settings. MIT-Press.