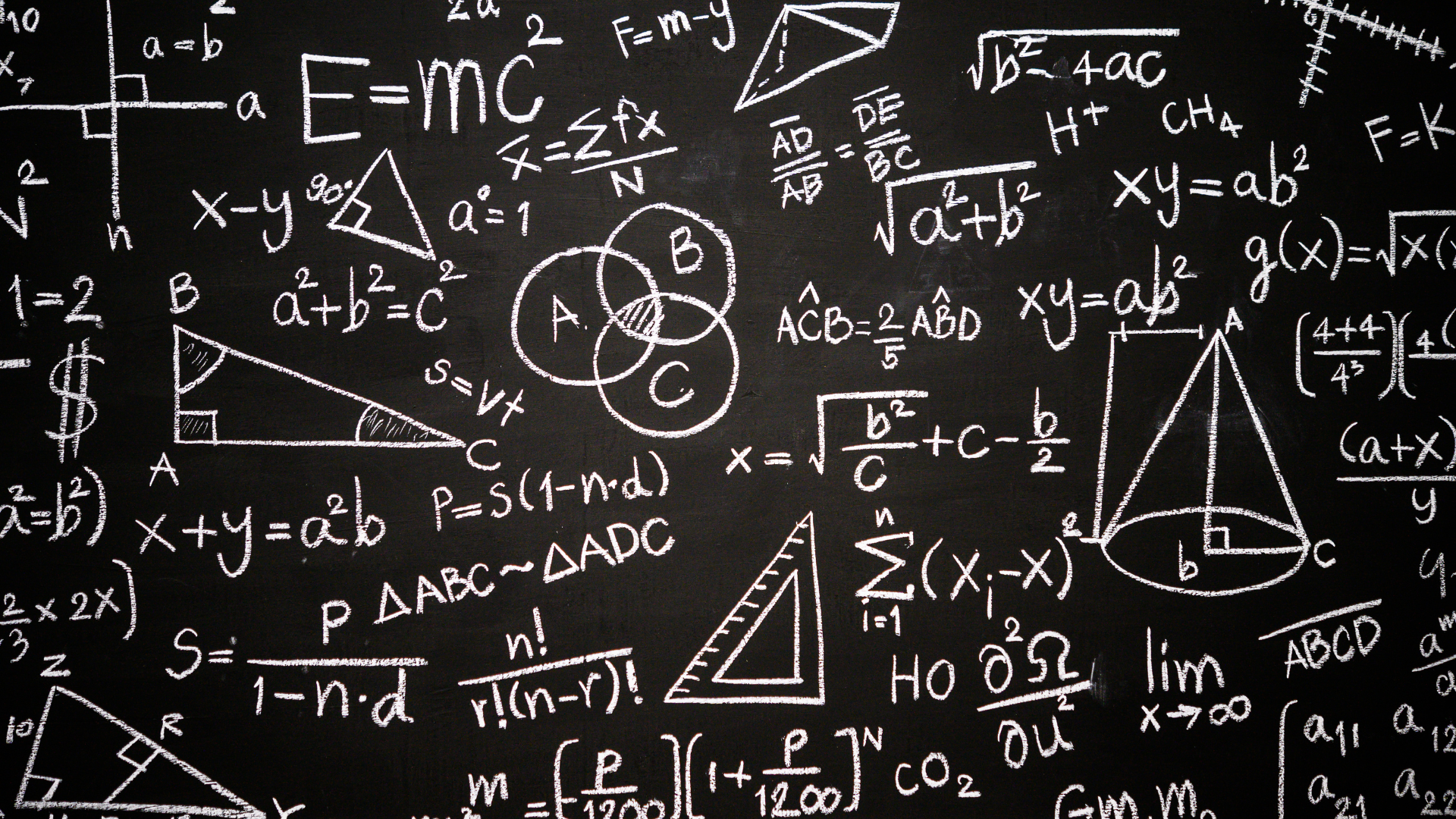Wenn Biologie und Technik zusammengeführt werden, entstehen daraus neue Werkstoffe, hochsensible Prothesen für Menschen oder Roboter mit künstlichen Sinnesorganen. Wissenschaftspionier Werner Nachtigall erklärt gegenüber dem MINT Zirkel, was Schülern die Beschäftigung mit dem Thema „Bionik“ bringt.
Die interessantesten Dinge geschehen im quirligen Grenzgebiet, in dem sich Disziplinen berühren und verzahnen“, schreibt Werner Nachtigall. Der emeritierte Professor ist selbst ein Grenzgänger, ein Wissenschaftspionier – er gilt als einer der Begründer der Bionik in Deutschland. Er studierte unter anderem Biologie, Physik, Chemie und Geographie, war Direktor des Zoologischen Instituts der Universität des Saarlandes, interessierte sich aber immer auch für technische Innovationen, die sich möglicherweise aus einer genauen Beobachtung der Tierwelt gewinnen lassen. So habilitierte er schon vor gut 50 Jahren über Flugbiophysik, die Technik des Fliegens von Vögeln und Insekten also. In der Bionik geht es nicht darum, die Natur zu kopieren. Das ist nicht möglich. Die Natur soll als Inspiration für technische Innovationen und Optimierungen dienen. „Bionik als wissenschaftliche Disziplin befasst sich mit der technischen Umsetzung und Anwendung von Konstruktions-, Verfahrens- und Entwicklungsprinzipien biologischer Systeme“, so lautet die Definition des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). In der Bionik – das Kunstwort setzt sich aus den Begriffen „Biologie“ und „Technik“ zusammen – arbeiten Biologen eng mit Ingenieuren, Architekten, Physikern und Materialforschern zusammen.
Bionik in der Praxis
Grundsätzlich gibt es zwei Herangehensweisen in diesem Forschungsgebiet: Entweder steht am Anfang eine technische Fragestellung, für die in der Natur nach Vorbildern und Lösungen gesucht wird („Top- Down-Prozess“) oder ausgehend von einer biologischen Erkenntnis werden Anwendungsmöglichkeiten für die Technik gesucht („Bottom-Up-Prozess“). Da Vinci handelte eher nach dem Top-Down-Prozess. Die Erfindung des Klettverschlusses hingegen gilt als Beispiel für einen Bottom-Up-Prozess. Dem Schweizer George de Mestral soll 1941 die Idee zu dem neuen Verschluss- Systems gekommen sein, nachdem sich sein Hund beim Spaziergang einige Kletten eingefangen hatte und Mestral sie unter dem Mikroskop untersuchte. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit ist das „Gecko- Tape“, eine neue Hightech-Folie, die durch eine spezielle Oberflächenstruktur wie ein Klebstoff klebt, aber spurlos wieder entfernt werden kann. Dieses Tape hat sich an den Haftmechanismen von Gecko- und Käferfüßen ein Beispiel genommen. Auch die dreibeinigen Fundamente von Windkrafträdern im offenen Meer haben sich ein Vorbild an der Natur genommen, genauer gesagt am Plankton Clathrocorys teuscheri und seinen dreistrahligen Skeletten.
Bionik als Thema in der Schule
Mit diesen und ähnlichen Beispielen können Schülerinnen und Schüler begeistert werden, weiß Werner Nachtigall aus Erfahrung. Früher hat er viele Vorträge an Schulen gehalten und dabei auf die Ziele sowie Relevanz der Bionik hingewiesen. „Ich habe dabei eigentlich nie etwas anderes erlebt als Interesse bis Begeisterung“, erzählt der heute 81-Jährige. „Für die Einsicht der jungen Generation, dass Biologie und Technik nicht unbedingt Feinde, ja nicht einmal wesensfremd sein müssen, sind die Schulen mit ihren Lehrplänen gefordert“, so Nachtigall, „ich bin eh dafür, die Fächer zwar nicht aufzulösen, aber an den Rändern mehr zusammenzuführen.“
Ideengeber für die Zukunft
Insgesamt gibt es mehrere Teilbereiche der Bionik wie beispielsweise Werkstoffbionik, bionische Robotik oder Klima- und Energiebionik. Werner Nachtigall würde sich noch mehr Institutionen wünschen, die Forschung in diesen Gebieten vorantreiben: „Die Bionik ist noch nicht allzu lange ins Bewusstsein der Gesellschaft und der Industrie gerutscht. Ihre Nutzung im großflächigen Sinn beginnt eben erst.“ So auch im Energiesektor. „Dem technischen Prinzip der Energieerzeugung unter Abfallanhäufung und Umweltzerstörung steht das Naturprinzip der zerstörungsfreien totalen Sonnenenergienutzung gegenüber“, schreibt Nachtigall in einem Aufsatz. Erste Beispiele effektiver Nutzung umweltverträglicher Energieformen sind Fotovoltaik-Zellen, die sich am Prinzip der Fotosynthese orientieren – Lernen von der Natur, um die Probleme der Menschheit zu lösen.
Laura Millmann