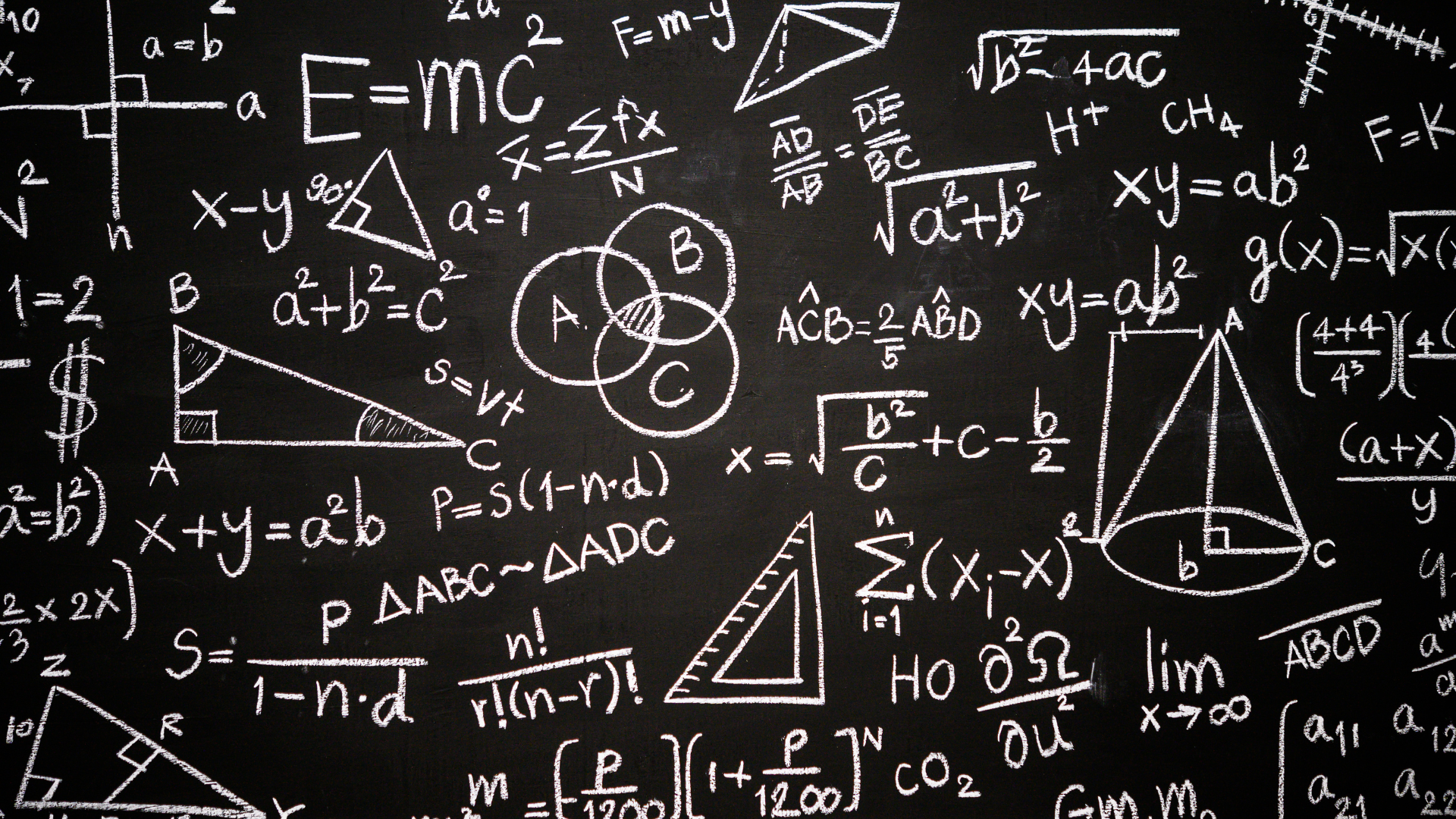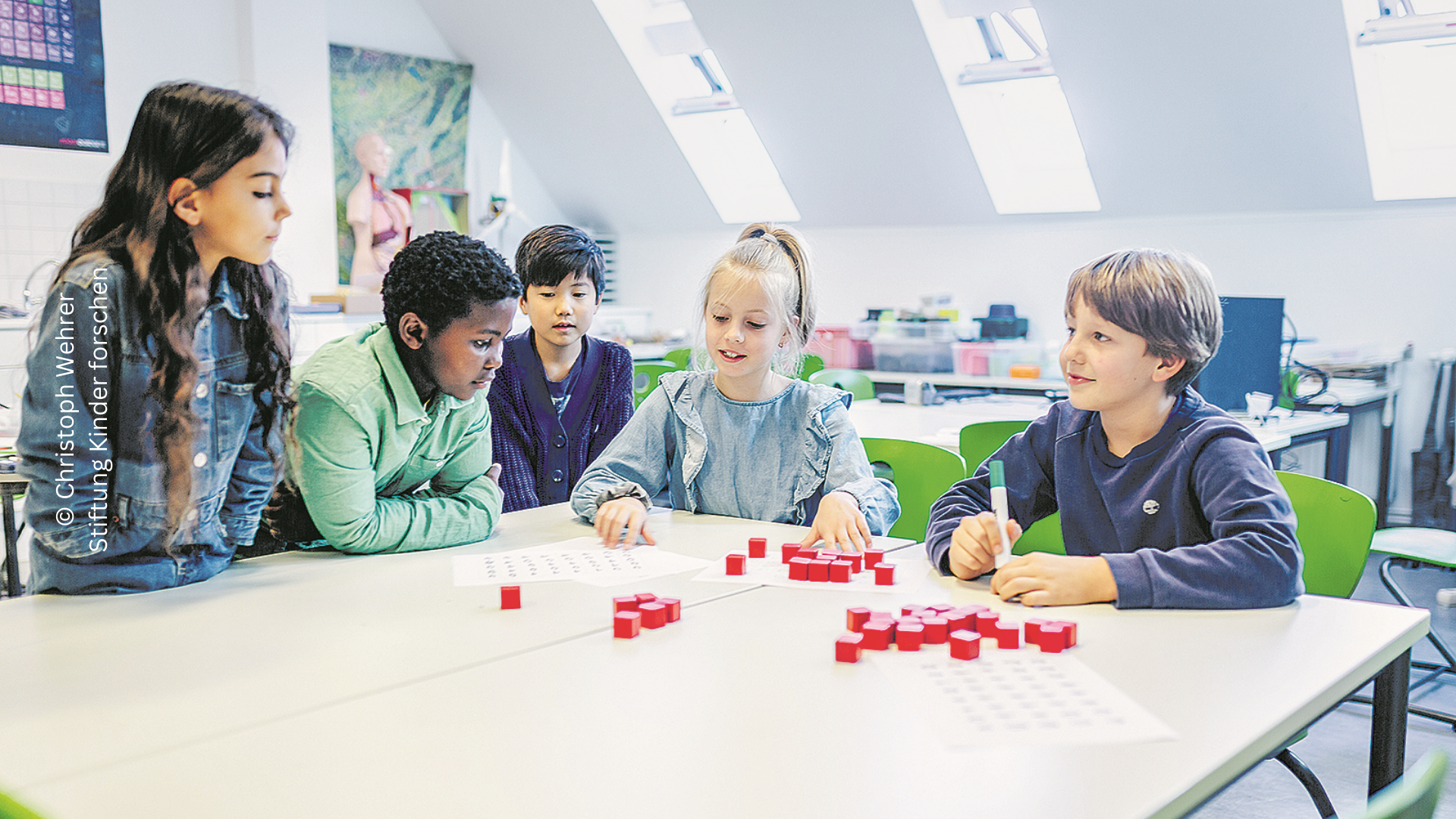Häufig lernen Schülerinnen und Schüler Inhalte oder Zusammenhänge nur auswendig, anstatt sie wirklich zu durchdringen und zu einem tieferen Verständnis zu gelangen. Lehrkräfte können dem entgegenwirken, indem sie Lernende zu Selbsterklärungen anregen. Wie wirksam sie im Vergleich zu anderen Formen der Unterstützung sind, untersucht eine aktuelle Metaanalyse. Die bisherige Forschung konnte zeigen, dass Schülerinnen und Schüler deutlich wirksamer lernen, wenn sie beim Lernen spontan und von sich aus regelmäßig ihr Verständnis überprüfen und versuchen, sich Zusammenhänge selbst zu erklären: Sie erschließen sich dadurch ein tieferes Verständnis und erbringen allgemein bessere Lernleistungen. Allerdings tendieren viele Schülerinnen und Schüler dazu, Inhalte und Prozessabläufe eher auswendig und damit oberflächlich zu lernen. Lehrkräfte können Lernende jedoch mit verschiedenen Impulsen zum Selbsterklären anregen. Eine Metaanalyse von Bisra, Kolleginnen und Kollegen aus dem Jahr 2018 untersucht deshalb, ob Selbsterklärungsimpulse tatsächlich dazu führen, dass Lernende Inhalte besser verstehen, erinnern und auf neue Sachverhalte anwenden können.
Können Selbsterklärungen die Lernleistung verbessern?
Die Autorinnen und Autoren der Metaanalyse konzentrieren sich auf verschiedene Arten von schriftlichen Impulsen, die Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten von Aufgaben bekommen. Sie wollen herausfinden, ob Anregungen zum Selbsterklären auch im Vergleich zu anderen Formen der Unterstützung – wie instruktionalen, d. h. vorgegebenen, Erklärungen oder inhaltlichen Zusammenfassungen – im Hinblick auf den Lernerfolg wirksamer sind. Auf der Basis von fast 6.000 Probanden – darunter Schülerinnen und Schüler sowie Erwachsene – kommt die Metaanalyse zu dem Ergebnis, dass Lernende im Durchschnitt höhere Lernleistungen im Erinnern, Erklären und Anwenden von Inhalten zeigen als diejenigen, die keine zusätzlichen Impulse erhalten. Dies gilt für alle untersuchten Fächer, darunter Mathematik, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften und Technik. In geringerem Ma.e gilt dies auch im Vergleich zu inhaltlichen Erklärungen oder anderen Impulsen, die die Lehrkraft bei der Bearbeitung von Aufgaben anbietet. Dabei zeigt sich grundsätzlich, dass die meisten untersuchten Selbsterklärungsimpulse ähnlich wirksam sind. Hervorzuheben ist allerdings, dass Impulse, bei denen Lernende sich Begriffe selbst erklären müssen, deutlich effektiver sind als metakognitive Impulse – d. h. Impulse, die die eigene Planung oder Lösung reflektieren.
Selbsterklärungen im Biologieunterricht
Ein konkretes Beispiel, wie solche Impulse im Unterricht eingesetzt werden können und wie sie sich im Verhältnis zu anderen Formen der Instruktion auswirken, zeigt eine Studie von Eckhardt et al. aus dem Jahr 2013. An der Studie im Biologieunterricht der achten Klasse nahmen 124 Schülerinnen und Schüler teil. Im Themenbereich „Ökosystem Wasser“ war das Lernziel, dass Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung von Jäger- und Beutepopulationen verstehen. In einer computerbasierten Lernumgebung konnten die Schülerinnen und Schüler im Sinne des Forschenden Lernens Vorhersagen zur Entwicklung der beiden Populationen aufstellen. Mithilfe einer Computersimulation testeten sie ihre Vorhersagen und konnten ihre Ergebnisse anschließend interpretieren. Die Studie untersucht, welche Art der Unterstützung Schülerinnen und Schülern insbesondere bei der Interpretation der Ergebnisse am wirksamsten geholfen hat. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterscheiden dabei drei Arten von Unterstützung, wobei die Schulklassen per Zufall einer von drei Untersuchungsbedingungen zugewiesen wurden:
Kurz erklärt: Selbsterklärungen
Sich selbst etwas zu erklären, ist eine kognitive Aktivität, durch die Lernende ein tieferes Verständnis von Lerninhalten entwickeln sollen. Im Gegensatz zu sogenannten instruktionalen, d. h. vorgegebenen, Erklärungen erschließen und erklären sich Lernende Begriffe, Sachverhalte und Zusammenhänge selbst.
Dabei werden sie konkret angeregt, Verknüpfungen zwischen den Inhalten von Aufgaben und ihrem eigenen Vorwissen herzustellen, sich bewusst zu machen, welche einzelnen Schritte zur Lösung einer Aufgabe nötig sind oder welche argumentativen Strukturen (z. B. These, Beleg oder Gegenthese) in einem Textabschnitt stecken. Manche Lernende zeigen dieses Verhalten spontan, andere müssen durch Fragen und andere Impulse dazu angeregt werden. Solche Impulse können vor, während oder nach der Bearbeitung von Aufgaben eingesetzt werden. Zu diesen Impulsen gehören Formulierungen wie „Erklären Sie diesen Begriff.“, „Begründen Sie diese Entscheidung.“, oder „Welchen Lösungsschritt wenden Sie an und warum?“. Zentral ist dabei, dass diese Impulse selbst keine zusätzlichen Sachinformationen oder Erklärungen enthalten. In der ersten Bedingung erhielten die Schülerinnen und Schüler den Auftrag, ihre Ergebnisse selbst zu beschreiben und zu interpretieren (Selbsterklärungsimpuls).
In der zweiten Bedingung gab das Computerprogramm eine komplette Interpretation der Ergebnisse für die Schülerinnen und Schüler aus (vorgegebene Erklärung). In der dritten Bedingung gab es – abgesehen von der Aufgabenstellung – keine weiteren Aufträge oder Hilfestellungen (ohne Unterstützung). Alle Schülerinnen und Schüler arbeiteten insgesamt zweimal 90 Minuten mit dem Lernmaterial. Die Ergebnisse der Wissenstests nach den jeweiligen Lerneinheiten zeigten, dass Selbsterklärungsimpulse die besten Leistungen erbrachten und auch vorgegebene Erklärungen zu besseren Leistungen führten als in der Versuchsbedingung, in der weder Erklärungen noch zusätzliche Unterstützung zur Verfügung standen.
Fazit für die Unterrichtspraxis
Die Metaanalyse zeigt auf der Basis von 20 Jahren Forschung, dass Schülerinnen und Schüler grundsätzlich davon profitieren, wenn sie bei Aufgaben dazu angeregt werden, sich Sachverhalte selbst zu erklären und intensiver über Zusammenhänge nachzudenken. Die Befunde zeigen zudem, dass Impulse zu Selbsterklärungen im Durchschnitt auch effektiver sein können, als wenn Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern Erklärungen vorgeben. Sollen Schülerinnen und Schüler also ein tieferes Verständnis von Inhalten entwickeln, empfiehlt es sich für die Gestaltung von Lernmaterialien, Schülerinnen und Schüler dazu anzuregen, erst einmal selbst genauer nachzudenken. Zum Beispiel können sie sich selbst erklären, was sie unter einem bestimmten Begriff verstehen. Offen bleibt in diesem Zusammenhang allerdings die Frage, wie Selbsterklärungen bei komplexen Sachverhalten oder bei Schülerinnen und Schülern mit geringem Vorwissen abschneiden. Womöglich sind digitale Angebote mit adaptiven Methoden – ähnlich wie im beschriebenen Studienbeispiel – ein hilfreiches Instrument für die Zukunft. Für gesicherte Antworten bedarf es allerdings weiterer Forschung in diesem Bereich.
Dr. Maximilian Knogler
Annika Schneeweiss