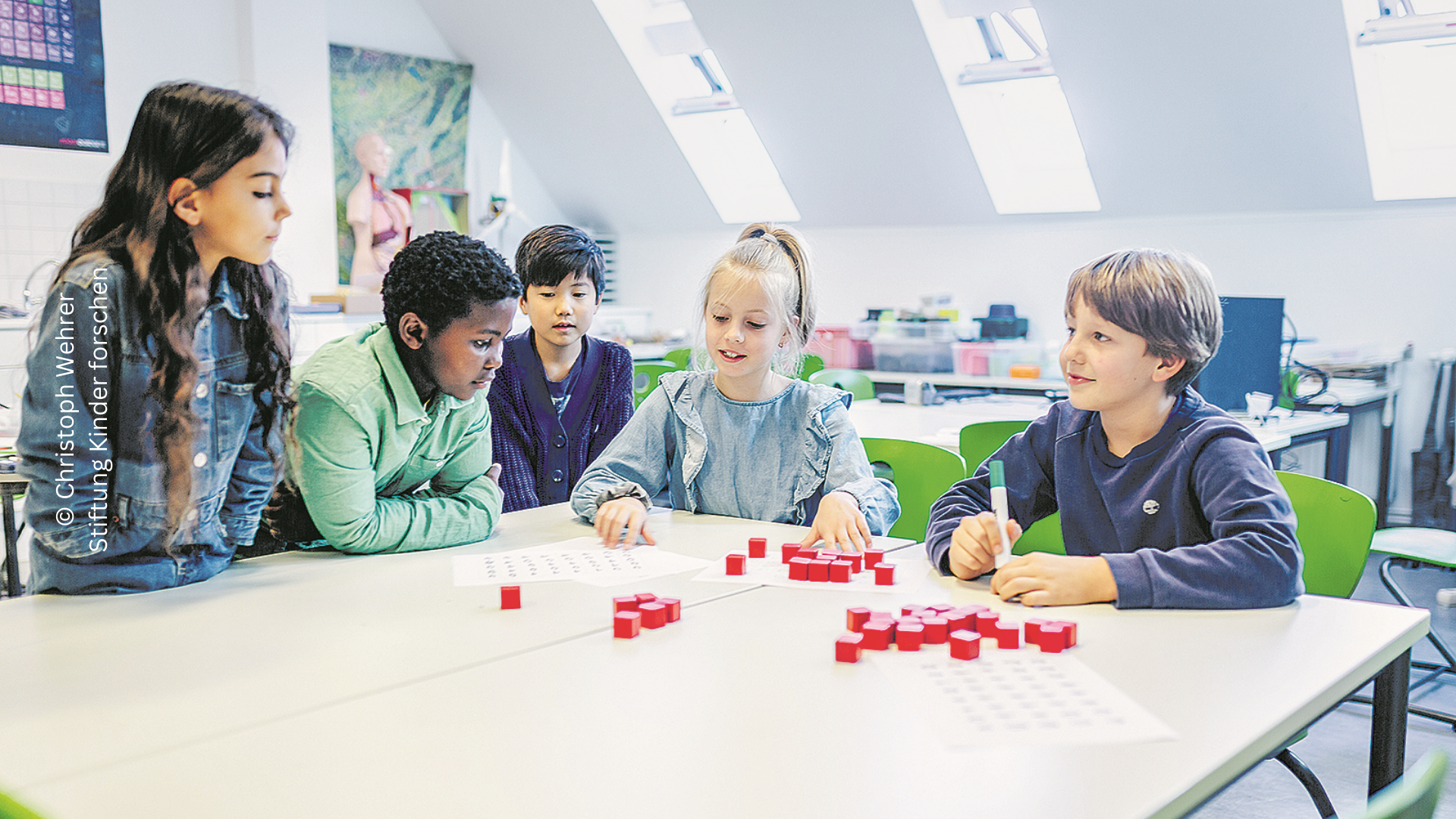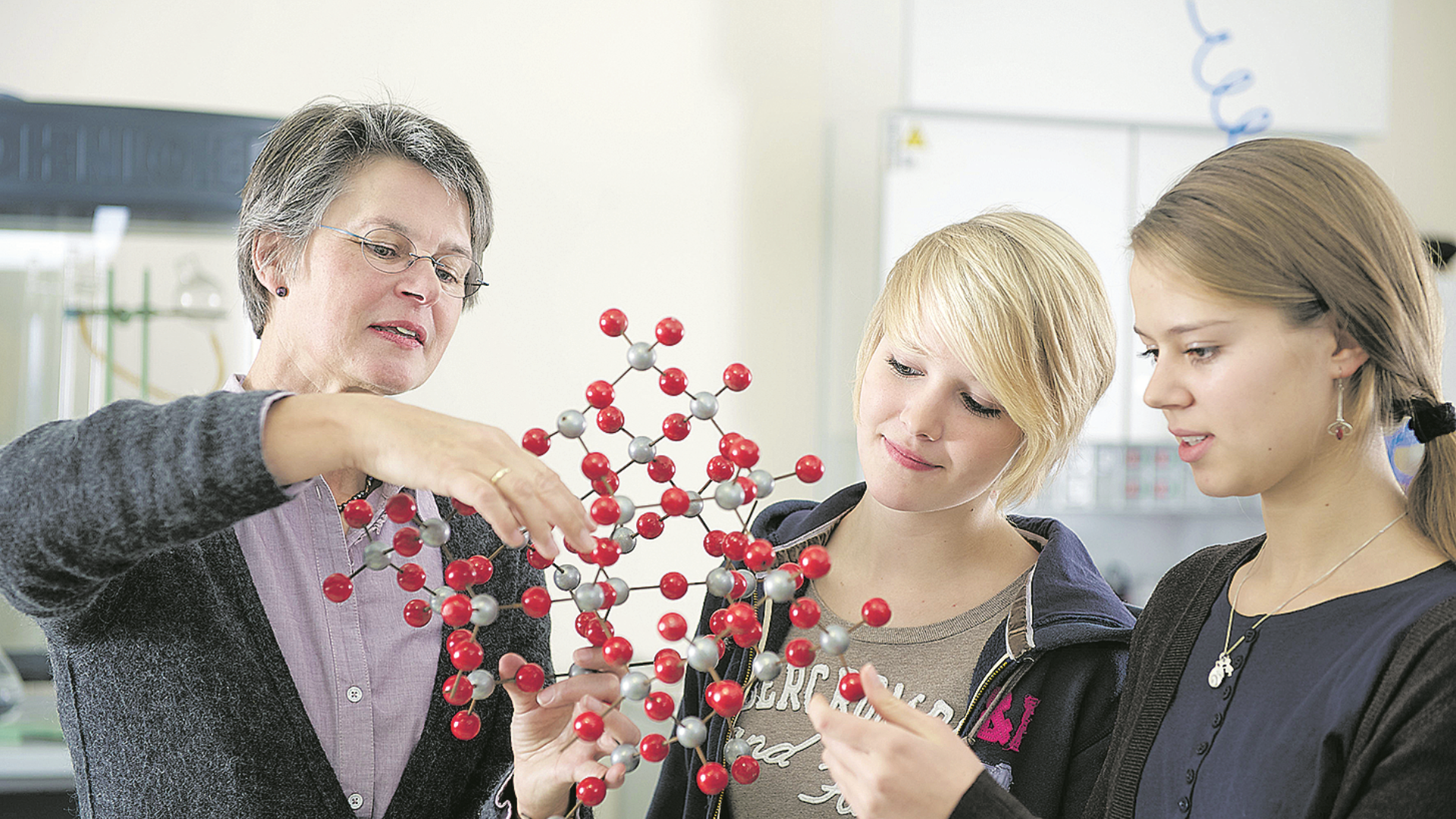Während alle vom Klima reden, findet weitgehend unbemerkt ein vom Menschen verursachtes Artensterben statt. Diese „Defaunation“ des Anthropozäns – die Entleerung der Tierwelt in der Menschenzeit – ist der neue Klimawandel: eine weitere große Bedrohung der Menschheit.
Als der amerikanische Astronaut William Anders vor einem halben Jahrhundert, am Heiligabend 1968, mit der Apollo-8-Mission in 780 Kilometer Höhe den Mond umrundete, sah und fotografierte er erstmals den Aufgang der Erde über dem Mond. Das Bild „Earthrise“, der Anblick unseres Heimatplaneten aus dem Weltall, wurde zum Symbol für die Fragilität und die Isolation der Erde im Kosmos. Dieser Blick markiert zugleich den Beginn eines neuen Umweltbewusstseins. Vielleicht beeindruckt uns das Bild dieser kleinen blauen Murmel vor dem unendlichen Schwarz des Universums bis heute auch deshalb so sehr, weil uns dabei klar wird, dass wir Erdlinge nur diesen einen Planeten haben. Selbst wenn Menschen irgendwann einmal zum Nachbarplaneten Mars fliegen, zum Leben haben wir nur diesen einen Planeten Erde, den wir schützen und erhalten müssen.
Diese Perspektive auf die Erde hält zudem ein Paradoxon bereit: Wir geben Milliarden Dollar für Versuche aus, zum Mars zu fliegen, um dort etwa Spuren von fossilem Wasser zu finden, während wir auf der – eigentlich falsch benannten – Erde (deren Oberfläche zu 70 Prozent vom Wasser der Weltmeere bedeckt ist) nicht nur die Ozeane mit ihren Tiefen noch gar nicht hinreichend erkundet haben. Tatsächlich leben wir auf einem noch weitgehend unbekannten Planeten, den wir in biologischer Hinsicht noch keineswegs hinreichend kennen. Denn der Großteil irdischer Tier- und Pflanzenarten ist bisher noch unentdeckt und unbekannt, wissenschaftlich weder benannt noch beschrieben. Das gilt zwar kaum noch für die auffälligen Wirbeltiere wie Vögel oder Säugetiere, umso mehr aber für das Heer eher unscheinbarer Wirbelloser – etwa Gliedertiere wie vor allem Insekten, aber auch Spinnen, Krebse oder Schnecken. In erster Näherung sei beinahe jedes Tier ein Insekt, so das Bonmot der Biosystematik angesichts der tatsächlichen Artenfülle just jener Arthropoden. Aktuelle Schätzungen gehen von acht Millionen Spezies aus. Dagegen wurde bisher gerade einmal ein Viertel dieser ungeheuren Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten systematisch erfasst; wobei etwa Bakterien und andere Mikroben hier gar nicht berücksichtigt sind. Diese Biodiversität ist nicht nur der größte Reichtum der Erde – und zwar nur auf diesem Planeten; sie ist auch im globalen Maßstab bedroht.
Geschickt rotieren
In der Erdgeschichte sind fünf größere Massenaussterbeereignisse dokumentiert, beim letzten verschwanden vor 66 Millionen Jahren infolge eines Meteoriteneinschlags unter anderem auch die Dinosaurier. Diesmal sind wir der Meteorit. Gegenwärtig verlieren wir weltweit in dramatischer Weise die biologische Vielfalt auf verschiedenen Ebenen – von der genetischen Konstitution einzelner Populationen über die Vielfalt der Organismenarten bis hin zu den Lebensgemeinschaften ganzer Ökosysteme. Bald werden in der Natur nicht nur die großen charismatischen Tierarten ausgestorben sein – wie etwa Tiger und Löwe, Elefanten und Nashörner, oder auch die Galapagos-Schildkröten, von denen einige Insel-Formen bereits für immer verschwunden sind. Längst sind in Afrika und Asien die Bestände von Großkatzen ebenso wie von anderen Großsäugern zusammengebrochen. Oft gibt es von ihnen nur noch Restbestände, in denen die letzten ihrer Art ums Überleben kämpfen.
Längst aber geht es nicht mehr nur um die sogenannten „Flaggschiffarten“ des Naturschutzes; auf dem Spiel stehen vielmehr die Bestände und das Vorkommen einer Vielzahl von Arten. Dieses Verschwinden der Vielfalt und Fülle der Arten beginnt unmittelbar vor der eigenen Haustür, im eigenen Garten und in unserer Kulturlandschaft, wo massenhaft Vögel und Insekten verloren gehen. In Deutschland sind davon nachweislich drei Viertel aller Fluginsekten betroffen; diese aber sind Nahrung etwa der Vögel.

In Europa verschwanden deshalb in den letzten vier Jahrzehnten allein 300 Millionen Acker- und Wiesenvögel; in Nordamerika dürften es sogar drei Milliarden (!) Vögel vor allem in landwirtschaftlich genutzten Flächen und in den Siedlungen sein. Betroffen von dieser „Defaunation“ – der Entleerung der Tierwelt – sind vor allem die letzten Urwaldregionen der Welt; aber auch Fließgewässer, die wir allerorten begradigen, eindeichen und durch Wehre und Staustufen verbauen. So haben wir hierzulande Lachs, Stint und Stör weitgehend verloren und mit ihnen zahllose andere Fische. Oder nehmen wir den Boden, den wir überdüngen und dessen Organismen wir vergiften. Durch all dies ist das Artensterben allgegenwärtig und reicht von den Regenwäldern bis zu den Korallenriffen, von den weiten Savannenlandschaften bis zur Tiefsee. überall haben die Verluste der Naturräume und ihrer Lebewesen eine erschreckende Dimension und Dynamik erreicht.
Dieser globale Verlust an Arten lässt die Lebensräume biologisch zu Wüsten werden. Eine Vielzahl einschlägiger Studien zeigt, dass auf allen sechs Kontinenten und in sämtlichen Lebensräumen die Bestände und Vorkommen von immer mehr Arten in dramatischer Weise und immer schneller schrumpfen. Ganze Regionen verarmen, übrig bleiben Allerweltsarten und einige wenige Artenwendegewinnler. Die Auswirkungen dieses rasanten Verlustes an biologischer Vielfalt aber dürfen wir nicht unterschätzen; sie sind von enormer ökologischer Brisanz – und auch für uns von erheblicher gesellschaftlicher Sprengkraft.
Das anthropogene Artensterben ist der neue Klimawandel
Gegenwärtig ist der menschengemachte Klimawandel in aller Munde. Dabei ist der vom Menschen verursachte massenhafte Exitus von Tieren und Pflanzen die wahre Krise des 21. Jahrhunderts. Denn ohne den einzigartigen biologischen Schatz der Artenvielfalt funktionieren die Ökosysteme der Erde nicht, auf die wir alle angewiesen sind. Auf ihnen basiert unsere Ernährung, angefangen von sauberem Wasser und gesunden Böden bis hin zu den unentgeltlichen Bestäuberdienstleistungen der Insekten, die so für Kaffee und Kakao, für Äpfel oder Tomaten sorgen. Wenn wir weiterhin Obst und Gemüse essen wollen, Fisch und Fleisch, dann brauchen wir dazu überall auf der Erde intakte Lebensräume, die aber nur von einer intakten Artengemeinschaft aufgebaut werden. Ohne eine vielfältige Natur können wir uns nicht ernähren und nicht überleben. Den wenigsten Menschen ist indes bewusst, in welchem Ausmaß wir von der Natur und einer vielfältig vernetzten Vielfalt ihrer Organismen abhängig sind – vom Brot bis zur Banane, vom Kaffee am Morgen über den Salat am Mittag bis zum Wein oder Bier am Abend. Deshalb sind der Erhalt der Arten, funktionierende natürliche Ökosysteme und die Ernährung der Menschheit das zentrale Zukunftsthema.
Kein Thema Überbevölkerung?

Doch die Dramatik und Dimension des gegenwärtigen Artensterbens ist den meisten Menschen nicht bewusst. Dabei geht es nicht zuletzt auch um das Thema Überbevölkerung, vor dem wir die Augen verschließen; weil es historisch mehrfach vorbelastet ist, als neokolonialistisch oder faschistisch verbrümt wird, weil es religiös aufgeladen ist. Sicher aber auch, weil alle früheren Kassandrarufe – etwa einer „population bomb“, die bald zündet – sich unter anderem dank der „grünen Revolution“ nicht erfüllt haben. Bevor sich aber die Wachstumskurve der Weltbevölkerung zum Ende des Jahrhunderts hin allmählich abflacht, werden es in den unmittelbar vor uns liegenden Jahrzehnten erst einmal mehr Menschen werden.
Mittlerweile leben 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde. Nach den jüngsten Prognosen, etwa der Vereinten Nationen, kommen im Mittel zwischen zwei und drei Milliarden Menschen bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts hinzu.
Bereits jetzt verbrauchen wir im Übermaß Ressourcen und Raum; was wiederum die biologische Vielfalt und das Überleben vieler Tierarten auf der Erde bedroht. Es werden aber nicht einfach nur mehr Menschen werden, die mehr Landwirtschaft betreiben und mehr Flächen dafür benötigen. Viele dieser Menschen wollen eine Lebensweise, wie wir sie ihnen bisher in den westlichen Industrienationen vorleben. Damit werden wir die natürlichen Lebensräume noch weiter überstrapazieren – selbst wenn wir modernste Agrartechnologien und molekulargenetische Innovationen in der Landwirtschaft einsetzen.
Um weitere zwei oder drei Milliarden Menschen zu ernähren, werden wir noch mehr Natur opfern. Mit unserer Art der Landnutzung und Landwirtschaft werden wir bei noch mehr Menschen, die alle satt werden und sich besser ernähren wollen, in die Zwickmühle geraten, noch mehr Nahrung auf noch mehr Fläche zu erwirtschaften. Daher werden Überbevölkerung und Ressourcenknappheit die Biodiversitätskrise verschärfen. Wenn unsere lange steil nach oben weisende Bevölkerungskurve irgendwann gegen Ende des Jahrhunderts endlich kippt, wenn unsere Form der Bewirtschaftung von Landschaften zur Ernährung des Menschen an ihre letzten Grenzen stößt, werden wir Menschen längst ein Artensterben globalen Ausmaßes verursacht haben. Dazu kommt, dass die Menschheit wohl kaum friedlich schrumpfen wird; eher ist zu befürchten, dass dies mit Verteilungskämpfen und Migrationsbewegungen, mit Hunger und Chaos, Kriegen und Krankheiten verbunden sein wird. Das aber wollen wir unseren Kindern und Enkeln ersparen.
Vom Ende der Evolution
Dafür bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Wir müssen mehr natürlichen Lebensraum erhalten und großflächig Naturlandschaften wirkungsvoll schützen. Statt der derzeit 15 Prozent an Land und sieben Prozent im Meer sollten zukünftig wenigstens 30 Prozent der Erde, besser noch 50 Prozent geschützt werden, um dort die Artenvielfalt zu bewahren. Zu diesem Ziel 30 Prozent geschützter Flächen bis 2030 hat sich unlängst auch die EU-Kommission in ihrer Vision eines „Green Deals“ bekannt. Es wird darum gehen, dies nun auch weiter international bei der Biodiversitätskonferenz im Mai 2021 im chinesischen Kunming zu verankern. Die nächsten Jahrzehnte bis Mitte des 21. Jahrhunderts werden darüber entscheiden, ob wir Millionen Tierarten vor dem Untergang retten – oder das Ende der Evolution jener Arten einleiten, mit denen der Mensch und seine Vorfahren während der vergangenen Jahrmillionen gemeinsam entstanden sind. Kein Zweifel: Das Leben wird andere Wege einschlagen, wenn es nicht gelingt; doch dann sehr wahrscheinlich ohne uns.
Matthias Glaubrecht
weitere Informationen:
Das „Globale Assessment“ des Weltbiodiversit.tsrates IPBES
Literaturtipp:
Matthias Glaubrecht
Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten
München: C. Bertelsmann 2019, 1072 S., 38 Euro