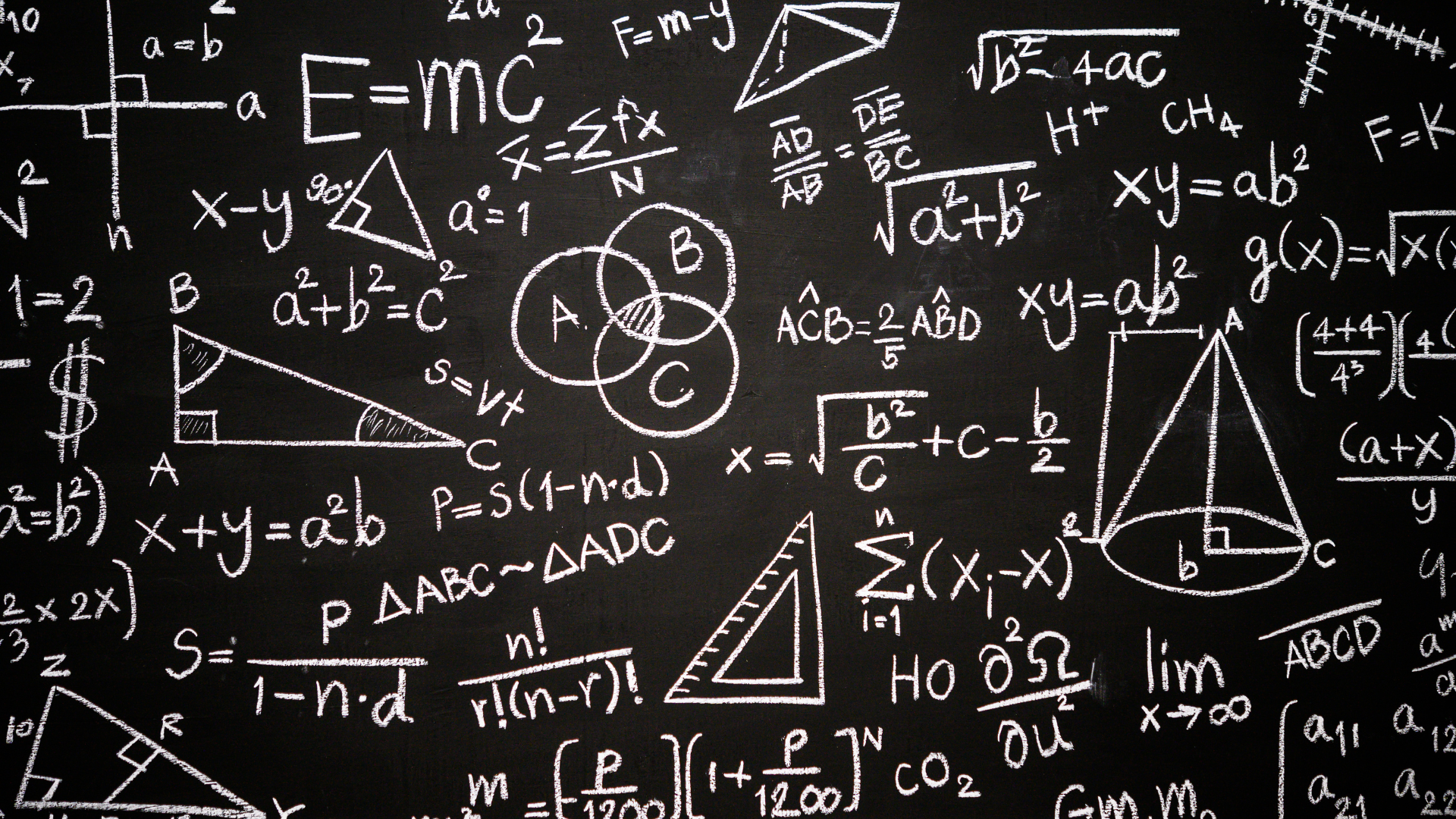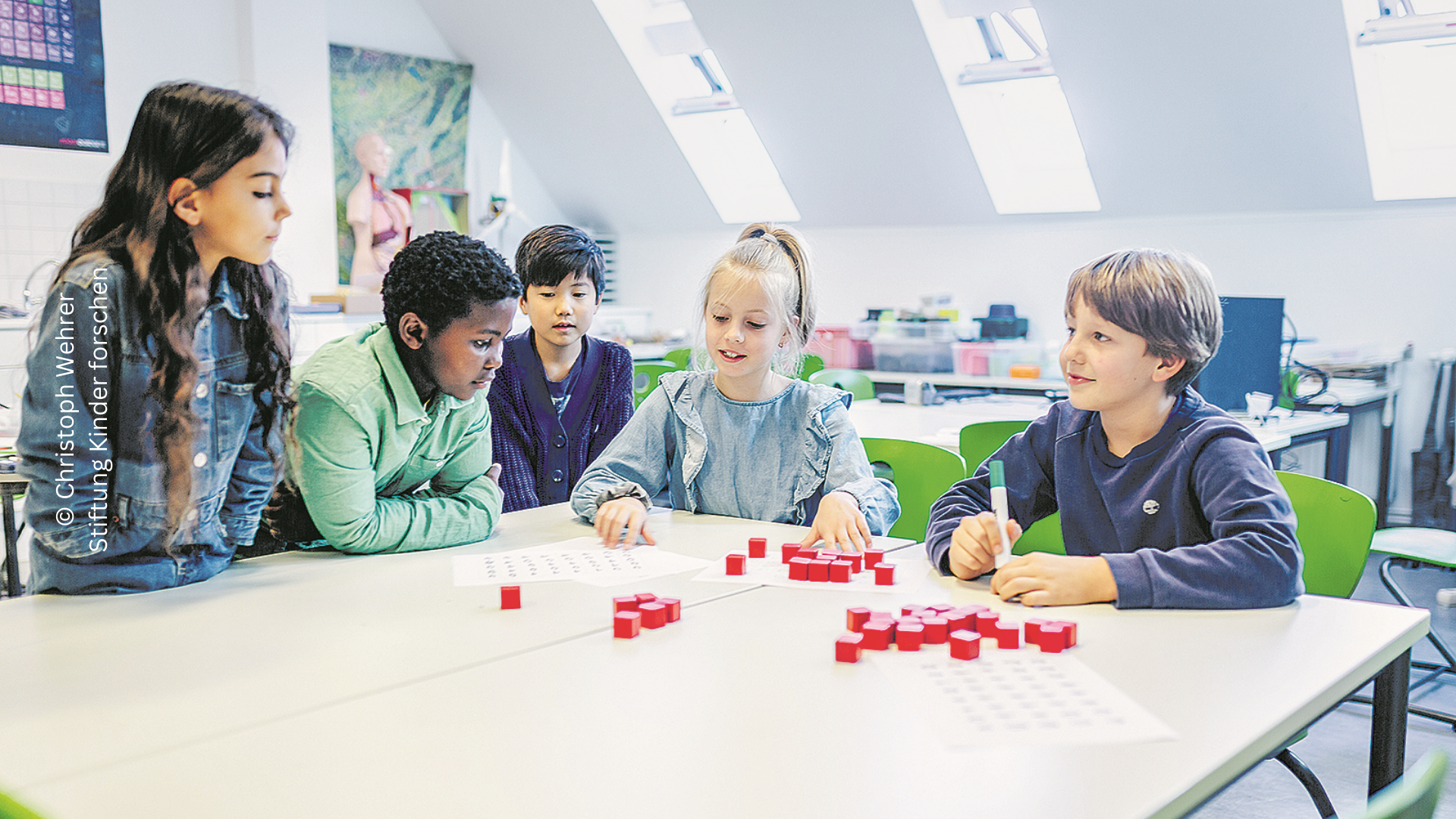Menschen verfügen über unterschiedliche Tierbilder. Aber welche Lernchancen bieten diese für den Umgang mit Tieren und wo liegen ihre Grenzen?
Tierethische Themen sind in gesellschaftlichen Debatten allgegenwärtig. Neben Langzeitthemen wie Massentierhaltung rückt derzeit aufgrund der Diskussion um die Herkunft von SARSCoV-2 auch der Umgang mit Wildtieren verstärkt in den Fokus. Nicht nur weil tierethische Fragestellungen demzufolge eine hohe Alltags- und Gesellschaftsrelevanz aufweisen, wird zunehmend erkannt, dass dem Fach Biologie bei der Bearbeitung tierethischer Themen besondere Verantwortung zukommt. Vor allem aber weist das Lebendige aus sich heraus ethische Bedeutsamkeit auf, sodass in diesem Zusammenhang auch normative Aspekte behandelt werden müssen. Mit Verabschiedung der Bildungsstandards wurde die Auseinandersetzung mit bioethischen Fragen ohnehin vorgegeben. Tierethik tangiert dabei verschiedene Bedürfnisse, Interessen, Probleme und erfordert ethische Analysen, in denen unterschiedliche fachliche Perspektiven zur Klärung beitragen. Fachdidaktische Untersuchungen verdeutlichen, dass die geforderte Mehrperspektivität eine große Herausforderung darstellt. So sind Bewertungen stärker durch monoperspektivische als durch multiperspektivische Vorstellungen gekennzeichnet. Auch Tierbilder zählen zu diesen individuell konstruierten Vorstellungen, wobei Menschen Tieren ganz unterschiedliche Eigenschaften zusprechen. Da sich diese Konstrukte zwar in der Reflexionsebene, aber nicht in ihrem subjektiven Wahrheitsgehalt unterscheiden, werden die verschiedenen Tierbilder bei Letzterem gleichgestellt, jedoch hinsichtlich ihrer Reflexionsebene bewertet. Deshalb ist es notwendig, auf Tierbilder von Schülerinnen und Schülern einzugehen und diese mithilfe fachlicher Klärungen zu reflektieren.

Mechanisches Tierbild
Was in den Köpfen von Tieren vor sich geht, beschäftigt Vertreter der Philosophie und Naturwissenschaft seit jeher. Im 17. und 18. Jahrhundert waren viele Menschen überzeugt, dass die Welt nach mechanischen Gesetzen funktioniere. Dieses Weltbild wurde v. a. durch die Vorstellungen von Ren. Descartes (1596–1650) geprägt. Infolgedessen wurden Tiere als seelenlose Automaten verstanden. Geist und Sprache waren die wichtigsten Kriterien zur Unterscheidung von menschlichen und tierlichen Wesen, biologisch-evolutionäre Kriterien wie Abstammung und Verwandtschaft nicht bekannt. Dennoch kritisierten schon Zeitgenossen das mechanische Tierbild und die vorherrschenden Unterscheidungskriterien. Trotz des immensen Zugewinns an ethologischem Wissen seitdem sind mechanische Tierbilder weiterhin verbreitet.
 Objektivierendes Tierbild
Objektivierendes Tierbild
Heutzutage setzen sich u. a. Tierschutzorganisationen dafür ein, dass tierliche Wesen nicht als leblose Sachen behandelt werden. Betrachten Menschen sie nämlich auf diese Art, so sprechen sie ihnen moralischen Eigenwert ab. Dadurch fällt es leichter, Tiere für eigene Zwecke zu nutzen, ohne dabei deren Bedürfnisse zu beachten. Auch rechtlich betrachtet gelten für sie teils dieselben Gesetze wie für Sachen (Åò 90a BGB). So ist es erlaubt, Tiere zu besitzen, sie zu (ver-)kaufen oder zu züchten. Im Unterschied zu leblosen Besitztümern ist ein willkürlicher Umgang mit ihnen aber untersagt. Nach dem Tierschutzgesetz (Åò 1) ist es beispielsweise verboten, einem Tier ohne „vernünftigen“ Grund Schmerzen, Leiden oder Sch.den zuzufügen. Wird ein Tier jedoch unabsichtlich oder in einer Notsituation verletzt, handelt es sich nicht um Körperverletzung, sondern um Sachbeschädigung (Åò 303 StGB).
Auch diese Ansichten bieten demnach keinen ausreichenden Schutz für Tiere. Aus tierethischer Perspektive sollte darüber nachgedacht werden, was ein vernünftiger Grund dafür sein kann, die Bedürfnisse von Tieren zu missachten (z. B. Trophäenjagd, Tötung für Pelzmäntel).
Anthropomorphes Tierbild
Um tierliche Verhaltensweisen nachzuvollziehen, gehen Menschen oft von eigenen Erfahrungen aus. So werden eigene Motivationen, Verhaltensweisen, Charakterzüge etc. auf Tiere übertragen. Dies kann dann angemessen sein, wenn die betreffende Tierart aufgrund ihrer Abstammung bestimmte Eigenschaften mit dem Menschen teilt. Wenn Menschen jedoch nur auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, wird von Anthropomorphismus gesprochen. Dieses Tierbild kann sowohl zu falschen als auch zu zutreffenden Urteilen führen. Tiere werden dabei als lebendige Individuen mit Gefühlen, Gedanken oder eigenem Willen angesehen. Anstelle von Willkür und Gedankenlosigkeit kann dieses Tierbild zu einer emotionalen Beziehung und einem sorgsamen Umgang führen. Anthropomorphe Tierbilder stoßen jedoch an ihre Grenzen, wenn tierliche Bedürfnisse übersehen und Verhaltensweisen fehlinterpretiert werden.

Individualistisches Tierbild
Für Charles Darwin (1809–1882) war es im Gegensatz zu Descartes offensichtlich, dass Tiere Individuen sind und über komplexe Gefühle und Intelligenz verfügen. Er setzte sich etwa mit der Frage auseinander, wie Tiere ihren Gemütszustand ausdrücken, schrieb z. B. von der Scham eines Hundes und widersprach damit der damals anerkannten Wissenschaftsmeinung. Auch wenn Darwins Forschungen bekanntlich nicht ausnahmslos verifiziert werden konnten, stützt sich die heutige Kognitionsforschung im Kern auf seine Erkenntnisse. Es ist etwas Abstraktes, Tiere zu verstehen. Schülerinnen und Schüler erkennen, dass es bestimmte Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Tieren, Maschinen, Sachen und Menschen gibt. Um tierliche Verhaltensweisen und Bedürfnisse zu veranschaulichen, wird dabei zu Recht verglichen. Im Biologieunterricht sollte hier aber geklärt werden, dass es nicht „das Tier“ gibt: Es w.re trügerisch, bei Millionen verschiedener Tierarten und Individuen generell vom „Tier“ zu sprechen. Ebenso lernhinderlich w.re es, ein Individuum allein nach seiner Artzugehörigkeit zu beurteilen. Da Lernende verschiedene Tierbilder mitbringen, sollten Gedanken, Aussagen und Handlungen hinterfragt werden, indem zwischen Tierarten differenziert und jedes Tier als Individuum betrachtet wird.
Jun.-Prof. Dr. Nadine Tramowsky, PH Freiburg
Download: Arbeitsblatt „Des Menschen Bild vom Tier“
Zum Weiterlesen: Der hier vorliegende Beitrag basiert auf dem Buch „Leben mit Tieren“ von N. Tramowsky, J. Groß und J. Paul (erschienen in der Reihe „Neue Wege in die Biologie“, Friedrich Verlag).