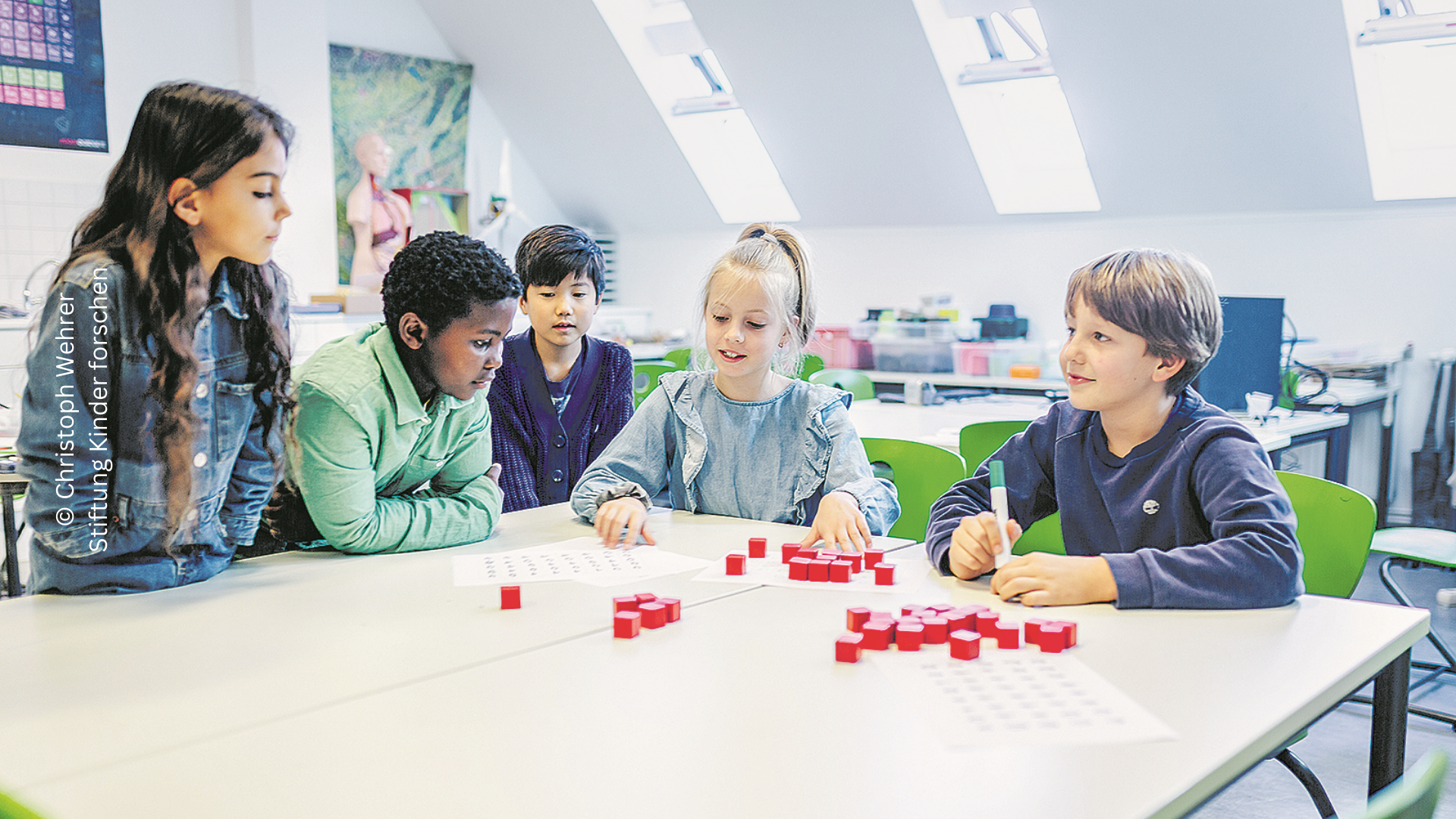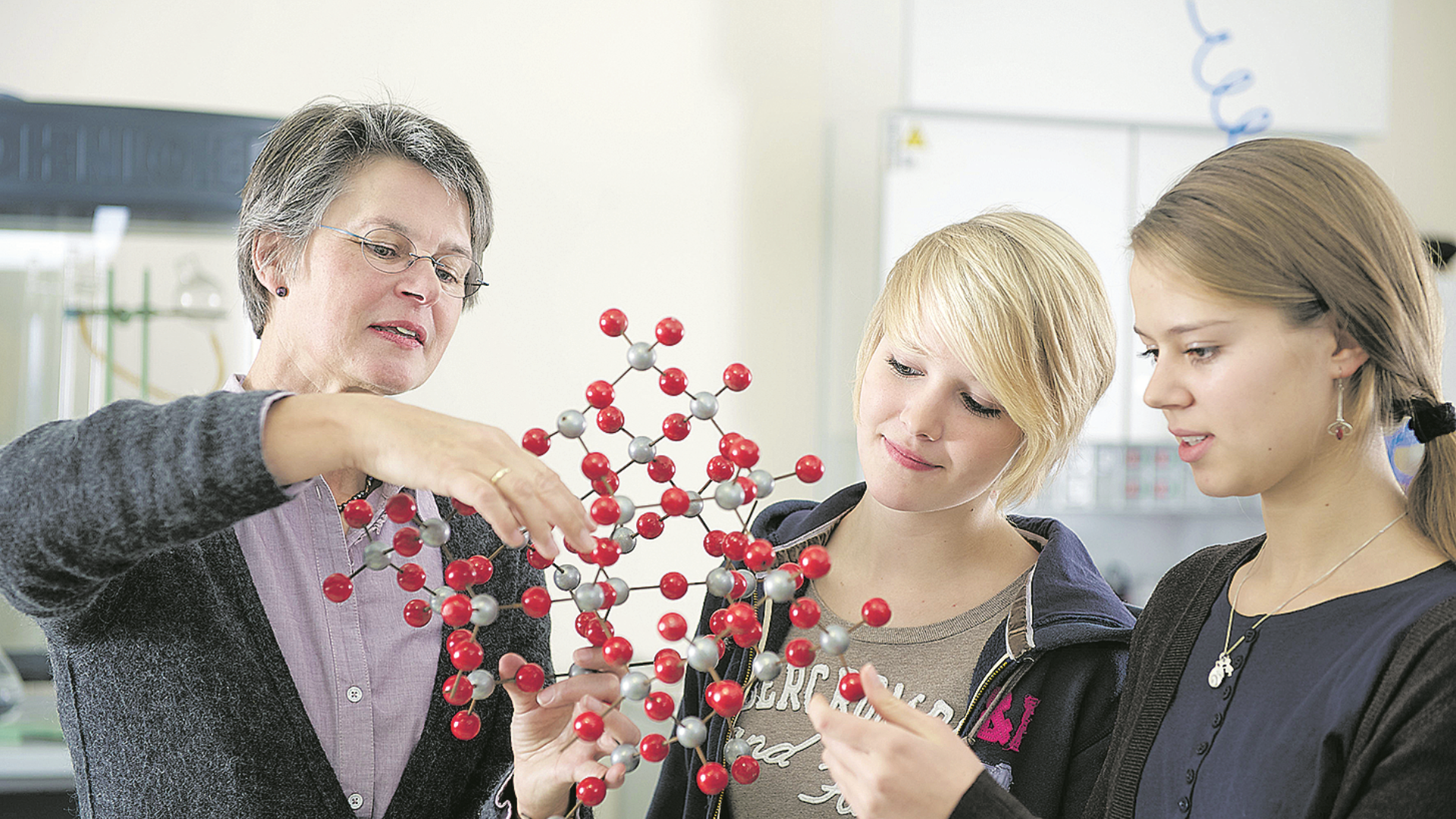Das Zusammenwirken im Bienenvolk ist außerordentlich komplex, flexibel und nicht hierarchisch gesteuert. Wie aber kann dann die Willensbildung und Kommunikation bei der Lösung von Problemen stattfinden?
Der Neurobiologe und Verhaltensforscher Thomas Seeley hat nachweisen können (The wisdom of the hive, the social physiology of honey bee colonies – 1995), dass es keine hierarchische Strukturen im Superorganismus Bienenvolk gibt. Er untersuchte den kollektiven Entscheidungsprozess des Bienenschwarms bei der Suche nach einer neuen Bienenwohnung und konnte zeigen, dass das außerordentlich komplexe Verhalten der Bienen den wechselnden Erfordernissen des Gesamtorganismus folgt, es ist nicht hierarchisch gesteuert und nicht allein an eine genetisch programmierte Abfolge von Drüsentätigkeiten gebunden.
Entscheidungsprozesse bei der Suche nach einer neuen Bienenwohnung
Entscheidungsprozesse bei der Suche nach einer neuen Bienenwohnung Bienenvölker nisten in unseren Breiten natürlicherweise in hohlen Bäumen. Geht es dem Volk im Frühjahr besonders gut, teilt es sich, und ein sogenannter Schwarm zieht aus. Das übrige Volk lebt weiter wie bisher. Etwa 15.000 Bienen und ihre Königin verlassen mit großem Brausen den Nistplatz des Volkes und sammeln sich in der Nähe an einem Ast als Schwarmtraube. Das ist die Geburt eines neuen Bienenvolkes.
Schwärmen bedeutet Risiko
Der Schwarm geht dabei ein existenzielles Risiko ein. Denn er lässt sein Wabenwerk mit den Honigvorräten und der Brut zurück. Die Bienen haben sich zwar mit Honig gesättigt, aber das reicht nur für drei Tage. Innerhalb dieser Zeit muss der Schwarm ein neues Zuhause finden, andernfalls sterben die Bienen. Diese wichtige Aufgabe wird wenigen hundert Spurbienen oder Scouts anvertraut. Dies sind erfahrene ältere Bienen, die die Landschaft genau kennen. Der Schwarm sendet seine Scouts in alle Himmelsrichtungen aus. In einem Radius von bis zu fünf Kilometer suchen sie unabhängig voneinander nach Nistplätzen.
Bewertung der Nistplätze
In Betracht kommende Hohlräume werden genauestens inspiziert. Im Laufe der Evolution haben sich eine Reihe von vorteilhaften Merkmalen für die Nistplätze ergeben. Die Untersuchungen von Seeley zeigen ein Ranking bei bestimmten Parametern. So wird ein Volumen von 40–60 Litern als optimal bewertet, eine Höhe von mehr als zwei Metern über dem Erdboden und eine Größe des Flugloches von etwa zehn Quadratzentimetern. Die Lage des Fluglochs hingegen spielt keine Rolle. Alle Aspekte der Untersuchung führt die Kundschafterin zu einer Gesamtbewertung der möglichen Nisthöhle zusammen.
Objektive und subjektive Bewertung
Bienen, die einen potenziellen Nistplatz entdeckt haben, fliegen zur Schwarmtraube zurück und werben mit Tänzen für den Platz. Im Tanz sind Himmelsrichtung und Entfernung des Nistplatzes verschlüsselt. Darüber hinaus bringen sie mit der Intensität ihres Tanzes eine zusammenfassende Bewertung des Nistplatzes zum Ausdruck. Die genetisch verankerten Kriterien werden getrennt erfasst. So kann z. B. ein zu großes Volumen zum Ausschluss führen. So erfolgt die Bewertung gewissermaßen „objektiv“ nach genetischen Kriterien. Die Kundschafterin bringt aber auch beim Tanz mit ihrer Intensität eine zusammenfassende subjektive Gesamtbewertung zum Ausdruck.
Auswahl
Die Kundschafterin ist wie ein Sinnesorgan des Schwarms, das die Qualität des Nistplatzes in die Stärke des Tanzsignals übersetzt. Manche der Scouts folgen solcher Einladung, andere lassen sich nicht verlocken, sondern gehen selbst auf Forschungsreise. Rekrutierte Bienen geben sich aber auch nicht mit der Bewertung ihrer Schwestern zufrieden. Sie führen eine eigene Untersuchung durch und kommen durchaus auch zu abweichenden Bewertungen, die sie wiederum durch die Intensität der eigenen Tänze bewerben. Die Scouts sind auch insofern autonom, dass sie entscheiden, ob sie selbst auf eigene Faust suchen oder den Vorschlägen anderer folgen. Und nachdem sie einen Platz eine Zeitlang beworben haben, können sie auch auf die Idee kommen, einen besseren zu suchen. Anschließend werben sie für einen Platz mit einer eigenen Gesamtbewertung. Auf diese Weise gewinnt das
„Gemeinwesen“ Kenntnis von vielen Nistmöglichkeiten. Durch die Autonomie der Individuen und deren gleichzeitiger Suche ergeben sich Alternativen. Allerdings ist keines der Individuen in der Lage, die Alternativen zu überschauen und selbst die beste Wahl zu treffen.

Wie entsteht aus Konkurrenz und tanzender Diskussion die Einigung?
Die Scouts haben eine Eigenschaft, die der Schlüssel zum Erfolg ist: Sie kritisieren nicht, sie bewerten nur selbst und drängen sich mit ihrer Bewertung niemandem auf. Denn auch für außergewöhnlich gute Plätze tanzen sie nur wenige Male. Und dabei lässt die Intensität der Bewerbung von gewissen Nistplätzen kontinuierlich nach, bis sie einfach aufhören. Das gilt auch für sehr gute Plätze. Sie werden nicht aufgedrängt. Dadurch erfolgt die Bewertung im Ganzen nicht zu schnell. Schwache Tänze bewirken ohnehin wenig oder keine nachfolgenden Tänzerinnen. Sie verlaufen schneller im Sande und stören nicht beim Entscheidungsprozess. Auf diese Weise vollzieht sich der Prozess nicht zu schnell, und Alternativen können tatsächlich entwickelt werden.
Die Fokussierung auf gute Stellen erfolgt dadurch, dass mehr Kundschafterinnen für einen Ort aktiv werden. Im Laufe der Zeit schälen sich über positive Rückkopplung Favoriten heraus.
Entscheidungsfindung vor Ort
Aufregend ist es nun, wie die Entscheidung herbeigeführt wird. Sie erfolgt nicht auf der Schwarmtraube, sie fällt an dem Ort, um dessen Bewertung es geht. Die Scouts fliegen wiederholt zu ihren guten Nistplätzen, gehen immer wieder hinein und fliegen um sie herum. Dadurch versammeln sich an einem favorisierten Platz immer mehr Kundschafterinnen. Sie achten darauf, wie viele von ihnen anwesend sind. Die Entscheidung erfolgt durch die gegenseitige Wahrnehmung bei der Bewertung der Lösung. Überschreitet die Zahl der Befürworterinnen ein gewisses Quorum, entsteht ein tragfähiger Konsens. Die Entscheidung führt zu einer abrupten Änderung ihres Verhaltens. Sie fliegen alle zum Schwarm zurück und erzeugen Pfeiftöne, mit denen der Schwarm aufgefordert wird, sich aufzuheizen, um sich für den Abflug vorzubereiten. Scouts, die für Alternativen getanzt hatten, stellen dies nun ein und orientieren sich an dem gewählten Platz. Nach etwa einer Stunde wird durch sogenannte Schwirrläufe der Kundschafterinnen der Impuls gesetzt, den Verband der Traube aufzulösen und sich als Wolke in die Luft zu erheben. Das Volk ist auf dem Weg zu seinem neuen Nistplatz.
Thomas Radetzki
Über den Autor:
Thomas Radetzki ist Initiator und Vorstand der Aurelia Stiftung und als „Bienenbotschafter“ bekannt. Er war maßgeblich an der Entwicklung der Richtlinien für ökologische Bienenhaltung in Deutschland und der EU beteiligt und ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der deutschen bienenwissenschaftlichen Institute.
Literaturtipps zum Thema:
Thomas Radetzki/ Matthias Eckoldt: Inspiration Biene erscheint Ende 2019. Sichern Sie sich Ihr kostenloses Exemplar unter: https://dev-mintzirkel.www92.pxia.de/unterrichtspraxis/inspiration-biene-das-sachbuch-bestellformular/