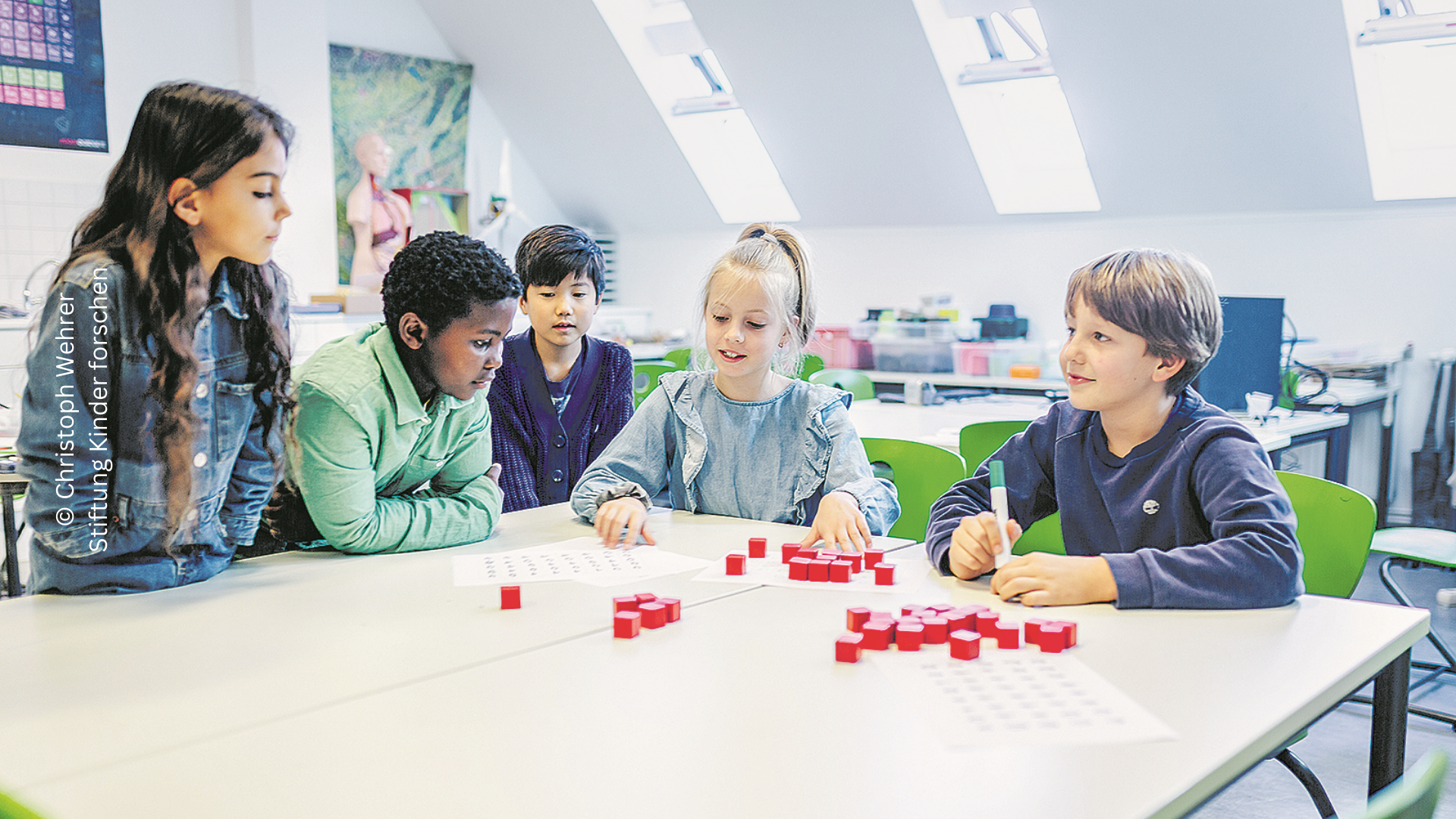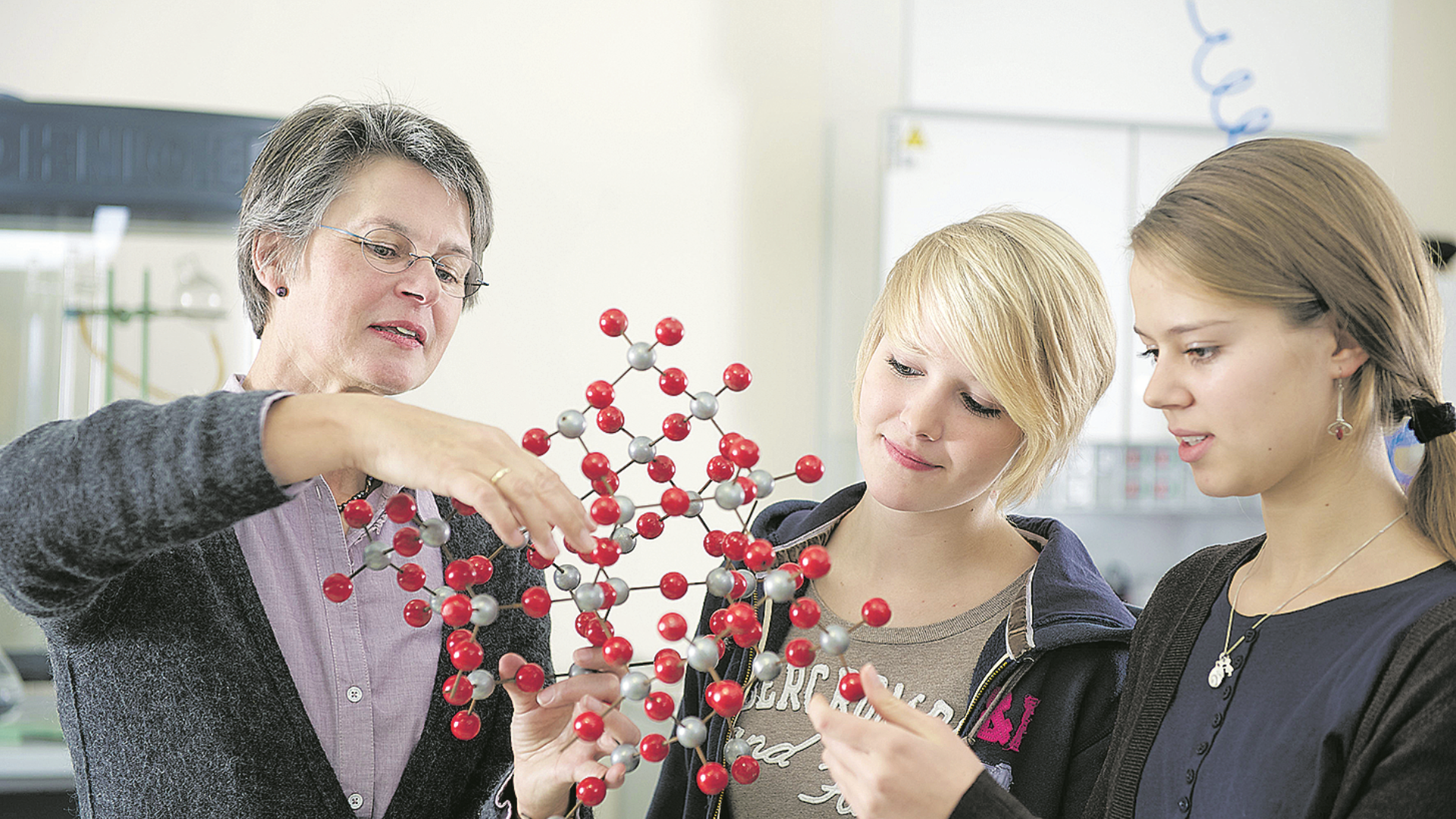Quantencomputer sind in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit ein zunehmend diskutiertes Thema. Sie basieren auf Gesetzen der Quantenmechanik, die im frühen 20. Jahrhundert entwickelt wurden und können genutzt werden, um Berechnungen durchzuführen, die klassischen Computern nicht zugänglich sind.
Manche Probleme sollten sich daher mit Quantencomputern schneller lösen lassen, die auf klassischen Computern (zu)viel Rechenleistung erfordern würden. Diese besonderen Computer sind heute keine reinen Gedankenkonstrukte mehr, in den letzten Jahrzehnten wurden erste Prototypen realisiert. Die Anzahl der Quantenbits – Qubits – dieser Quantencomputer ist allerdings noch extrem gering, sodass ihre potenziellen Fähigkeiten in den meisten Anwendungsfällen noch keine relevanten Vorteile gegenüber klassischen Computern besitzen.
Bits und Qubits
Auf klassischen Computern werden Informationen als Bits gespeichert und verarbeitet. Jedes Bit kann nur genau einen von zwei möglichen Zustände annehmen, nämlich 1 oder 0. Analog dazu gibt es die sogenannten Qubits, also quantenmechanische Bits. Dies sind quantenmechanische Systeme, die ebenfalls mit zwei Zuständen beschrieben werden können. Beispielsweise besitzt ein einzelnes Elektron – wie ein kleiner Stabmagnet – ein magnetisches Moment. Wird die Ausrichtung dieses magnetischen Moments entlang einer bestimmten Richtung gemessen, erhält man nur einen von genau zwei Werten, nämlich entweder eine Ausrichtung entlang (↑) oder entgegen (↓) der Messrichtung. Bis hierhin unterscheidet sich das durch die Zustände des Elektrons dargestellte Qubit nicht von einem klassischen Bit. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass sich ein Qubit auch in einer sogenannten Überlagerung der beiden möglichen Zustände befinden kann. Befindet es sich beispielsweise zu gleichen Teilen in den beiden Zuständen (quasi ↑ + ↓), so würde bei einer Messung mit einer Wahrscheinlichkeit P(↑) = 50 % die Ausrichtung ↑ bzw. mit P(↓) = 50 % die Ausrichtung ↓ gemessen werden. Dies bedeutet, dass das Qubit in beiden Zuständen gleichzeitig ist. Dies ist die zentrale Besonderheit der Quantenmechanik: Bei der Messung „entscheidet“ sich das Teilchen zufällig, in welchem Zustand es ist. Ist das Elektron in einem bestimmten Überlagerungszustand, so wird bei einer Messung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit P(↑) der Wert ↑, ansonsten ↓ gemessen wird. Im Allgemeinen kann sich die Messwahrscheinlichkeit beliebig auf die beiden Zustände verteilen, P(↑) und P(↓) müssen nicht gleich groß sein. Warum ist es aber wichtig, dass es Überlagerungen geben kann, wenn man doch immer nur einen der beiden Werte messen kann? Die Antwort ist, dass mit der Überlagerung dann sinnvoll gearbeitet werden kann, solange nicht gemessen wird. Und in ihr steckt deutlich mehr Information als in einem klassischen Bit, das nur zwei
verschiedene Werte kennt.
Vorteile und Ausblick
Was ist nun der Vorteil von Qubits gegenüber klassischen Bits? In einem klassischen System mit n Bits kann nur einer von 2n binären Zuständen, wie z. B. ↑↑↓↑↑↓↓↓, eingenommen werden, in der Quantenmechanik hingegen können alle 2n Zustände überlagert werden. Eine Operation auf einem Quantencomputer kann all diese Zustände gleichzeitig verarbeiten – solange nicht gemessen wird! Damit kann er bei bestimmten Problemen mit deutlich weniger Rechenschritten eine Lösung finden als ein klassischer Computer, der alle Optionen nacheinander probieren müsste. Ein solches Problem ist zum Beispiel das Knacken des RSA-Verschlüsselungsverfahrens, auf dessen Sicherheit heute Banken, Wirtschaft und die sichere Kommunikation im Internet vertrauen. Die Sicherheit dieser Verschlüsselung beruht darauf, dass es viel einfacher ist, zwei große Primzahlen zu multiplizieren (z. B. 11 · 13=143), als die Primfaktoren von 143 (11 und 13) zu finden. Der für Quantencomputer geschriebene Shor-Algorithmus ist jedoch in der Lage, die Primfaktoren großer Zahlen in deutlich weniger Rechenschritten zu berechnen als ein klassischer Computer, der bei großen Zahlen Jahrhunderte brauchen würde. Damit lägen den Entwicklerinnen und Entwicklern eines hinreichend großen Quantencomputers fast alle heute verschlüsselten Daten zu Füßen. Allerdings müsste dieser für sinnvolle Anwendungen aus mindestens einigen Hundert Qubits bestehen, heutige Quantencomputer weisen jedoch gerade mal ca. 10–20 gut funktionierende Qubits auf.
Leo Herrmann, juFORUM e. V.
Linktipps:
IBM Q – lernen und experimentieren direkt am Quantencomputer quantumexperience.ng.bluemix.net/qx
Wie funktionieren Quantencomputer? www.bit.ly/2qn2c7P
Bildnachweis:
Header-Bild © AB Electrical & Communications Ltd (https://www.abelectricians.com.au/)