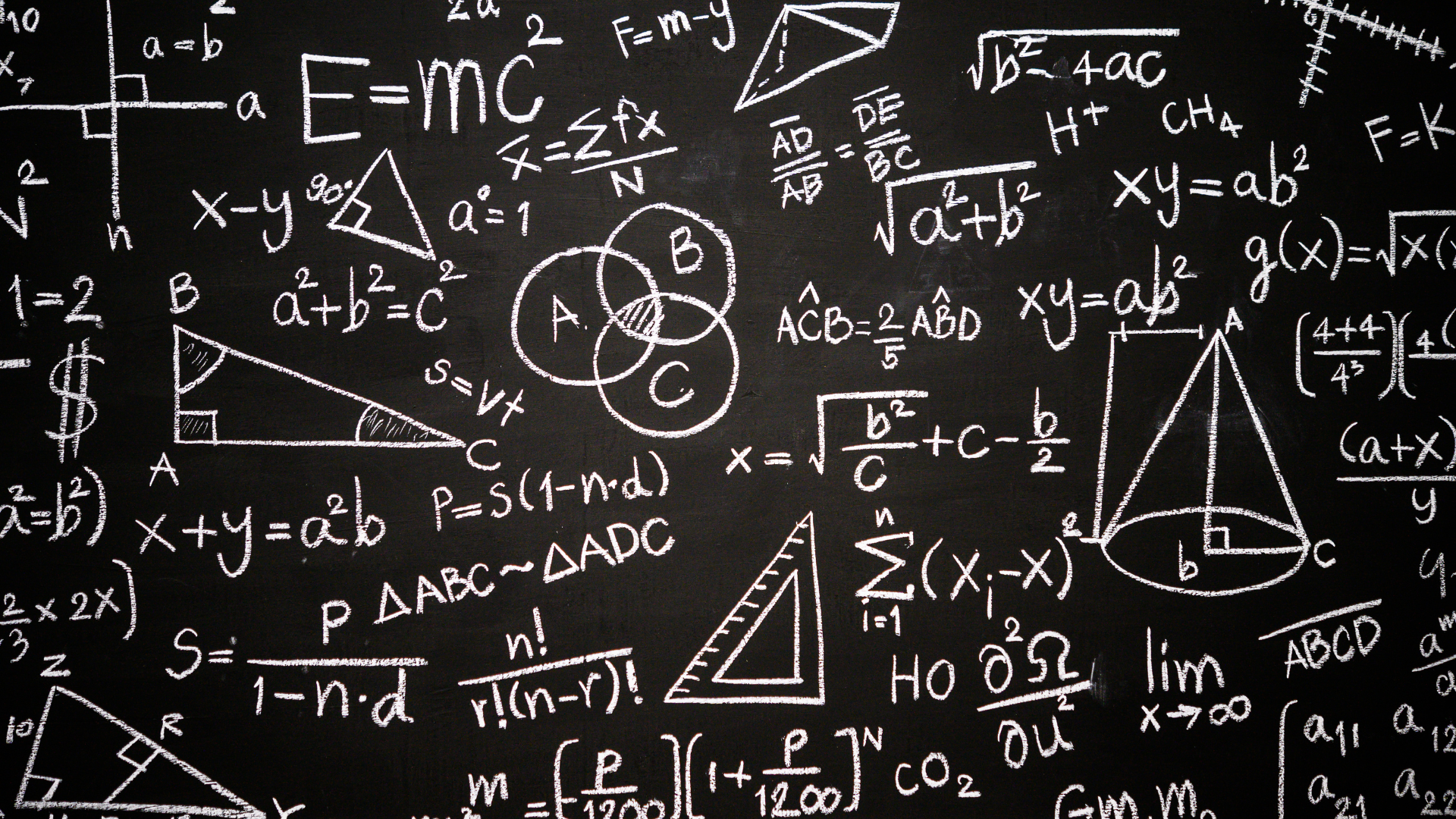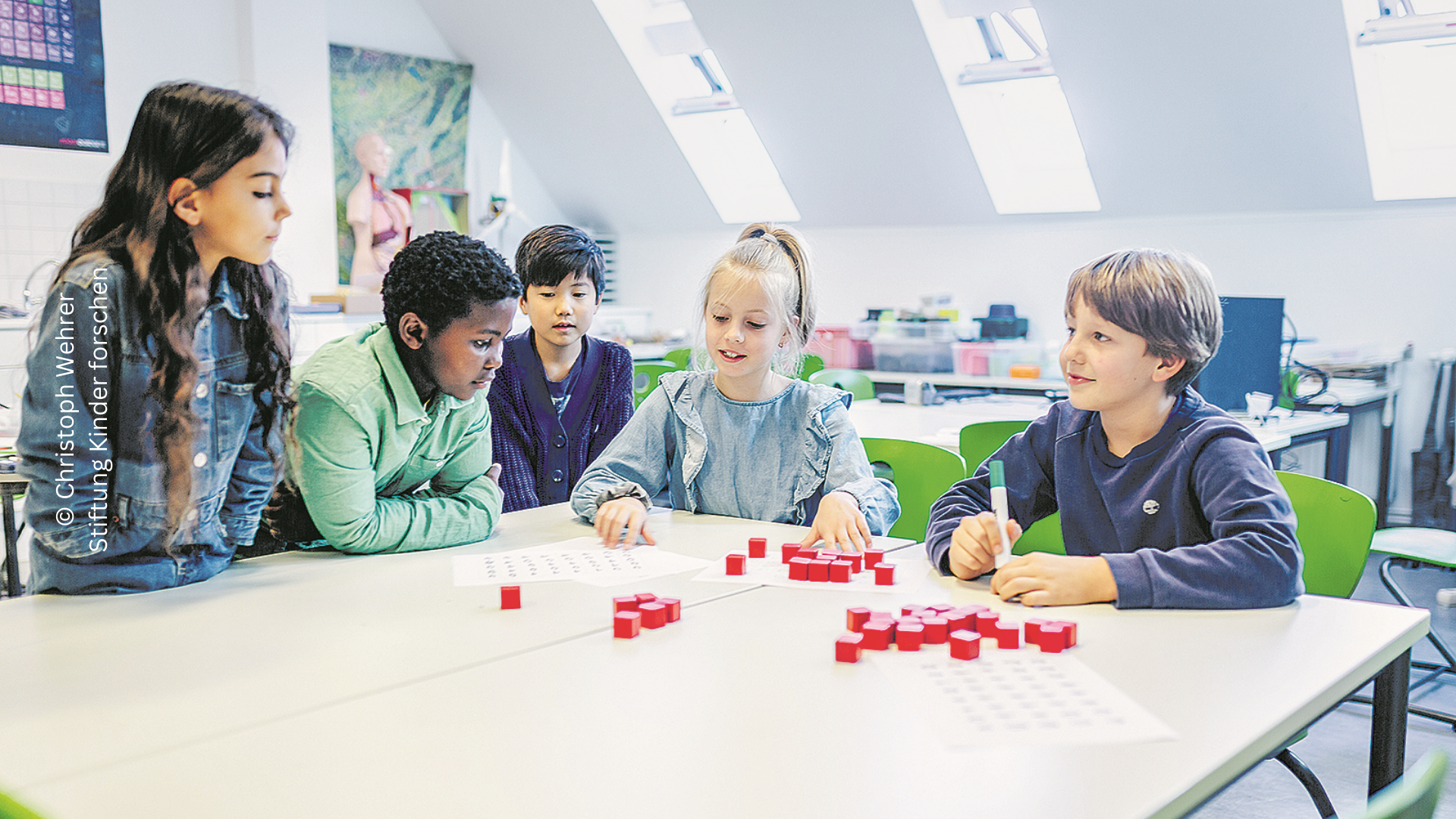Unser sichtbares Licht besitzt Wellenlängen im Bereich von 400 nm (Violett) bis 700 nm (Rot). Wir empfinden es als weiß, wenn viele dieser Wellenlängen in ihm enthalten sind oder eine geeignete Mischung aus mindestens Rot, Grün und Blau von unserem Auge wahrgenommen wird.
Dies nutzt man bei Bildschirmen und bei der modernen LED-Beleuchtung aus. Die Herstellung weiß-leuchtender LEDs war daher auch erst nach Erfindung von blauen LEDs 1994 möglich. Und ob weißes Licht uns eher bläulich oder gelblich erscheint, hängt vom spektralen Maximum ab, das durch die Temperatur des Strahlers bestimmt wird.
Spektrales Maximum
Temperatur und Wellenlänge des spektralen Maximums verhalten sich indirekt proportional zueinander (Wiensches Verschiebungsgesetz). Die Photosphäre der Sonne besitzt eine Temperatur von ca. 6.000 Kelvin, eine Halogenlampe kann nur unter dem Schmelzpunkt des Wolframdrahts, also unterhalb von 3.400 Kelvin betrieben werden und strahlt daher viel gelblicher als die Sonne. Die Angaben der Farbtemperatur bei einer LED bezeichnen die Lage ihres spektralen Maximums und haben daher nichts mit der tatsächlichen Arbeitstemperatur zu tun. Ein rotes Auto reflektiert den Rotanteil des Spektrums und absorbiert alle anderen Farben. Fehlt der Rotanteil im Spektrum der Lichtquelle, z. B. wenn der PKW unter einer reingelbes Licht ausstrahlenden Straßenlaterne parkt, sieht er faulig dunkelbraun aus. Dieses Experiment lässt sich einfach mit einer roten Paprikaschote nachmachen, die mit gelbem Licht beleuchtet wird: einmal mit dem Licht einer rein gelben LED und ein weiteres Mal mit gelbem Licht, das aus der Mischung der Strahlungen einer grünen und einer roten LED zusammengesetzt wurde. Nur im zweiten Fall würde man die Paprikaschote essen wollen …
Spektrale Zerlegung durch Beugung
Die Zerlegung von weißem Licht in seine Spektralfarben auf Grund der unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten verschiedener Farben (Dispersion) kennen wir vom Prisma oder vom Regenbogen. Spektrale Zerlegung von weißem Licht durch Interferenzen von Mehrfachreflexionen an dünnen Ölschichten auf Wasser oder an einer Seifenblasenhaut in Form bunter, sogenannter Newton-Ringe, hat auch fast jeder schon beobachtet. Das Licht erfährt eine spektrale Zerlegung aber auch durch Beugung und Interferenz an kleinen Strukturen wie Kanten, dünnen Drähten, Spalten oder Gitter. Die Beugung (Diffraktion) erzeugt Kugelwellen und führt zu einer Abweichung der Lichtausbreitung von der ursprünglichen Richtung. Die Überlagerung der Kugelwellen liefert Bereiche der Verstärkung (konstruktive Interferenz) und der Auslöschung (destruktive Interferenz), die für verschiedene Farben bei verschiedenen Winkeln beobachtbar sind. Gilt bei einem Betrachtungswinkel für eine Farbe Auslöschung, so sieht man die Komplementärfarben und/oder die Verstärkung einer anderen Farbe. Ein Beispiel dafür sind die brillanten Spektralfarben bei einer CD. Farben, die durch Beugung und Interferenz an Strukturen entstehen, nennt man strukturelle Farben. Man findet sie z. B. bei Schmetterlingsflügeln.
Experimentelle Beweise des Wellencharakters im Unterricht
Beugung und Interferenz sind eindeutige experimentelle Beweise für den Wellencharakter von Licht. Daher bietet es sich an, bei der Einführung elektromagnetischer Wellen im Unterricht der Sek II die Beugung von Licht an einer Gitterstruktur experimentell zu untersuchen. Da die Lagen der Beugungsmaxima, also die der konstruktiven Interferenzen, von der Wellenlänge des Lichts abhängig sind, sollte das Experiment mit diskreten Wellenlängen durchgeführt werden. Dafür kann man den Gitter-Aufbau des LASER-Optik-Kit „Snellius“mit zwei übereinander angeordneten Halbleiterlasern unterschiedlicher Farbe (grün und rot mit Wellenlängen von 532 nm bzw. 635 nm) nutzen und erhält mit dem beiliegenden Gitter mit einer Strichzahl von 300 pro Millimeter (Gitterkonstante d = 3,3 μm) das in Abbildung 1 dargestellte Beugungsbild. In ihm erkennt man neben der nullten Beugungsordnung, in der beide Farben übereinanderliegen, links und rechts symmetrisch jeweils drei Beugungsordnungen, in denen die beiden Farben getrennt sind. Man spricht hier links von der -1., -2., -3. bzw. rechts von der 1., 2., und 3. Beugungsordnung. Eine konstruktive Interferenz ergibt sich nur, wenn der Gangunterschied zwischen den interferierenden Wellen ein ganzzahliges Vielfaches N der Wellenlänge λ, also Nλ, ist. Aus einfachen geometrischen Überlegungen folgt, dass der Gangunterschied winkelabhängig ist. Verstärkung für eine bestimmten Wellenlänge findet man daher nur unter bestimmten Winkeln. Es gilt: Nλ = d sin α, wobei N die Nummer der Beugungsordnung, d die Gitterkontante und α der entsprechende Beugungswinkel sind. Aus der Formel ist sofort einsichtig, dass (a) in der nullten Ordnung die Maxima aller Wellenlängen übereinanderliegen und keine spektrale Zerlegung stattfindet, dass (b) in allen anderen Beugungsordnungen gilt, dass die Winkel, unter denen die jeweilige Beugungsmaxima beobachtet werden, bei längeren Wellenlängen größer sind als bei kleineren Wellenlängen. Dies stimmt mit dem Befund des beobachteten Beugungsbildes im Experiment überein: Rot wird stärker gebeugt als grün. Die räumliche Trennung verschiedener Farben, also die mögliche Auflösung eines Spektrums, wächst mit steigender Beugungsordnung.
Bestimmung der Wellenlänge
Man kann mit dem LASER-Optik-Kit „Snellius“ bei Kenntnis der Gitterkonstante d aus den gemessenen Beugungswinkeln von verschiedenen Beugungsordnungen die Wellenlänge der Lichtquelle bestimmen. Um möglichst geringe Fehler zu machen, bietet sich eine Auftragung von N für N von -3 bis +3 über sin α an. Legt man durch die sieben Punkte eine Gerade, erhält man als Anstieg d/λ. Umgekehrt kann man bei Kenntnis der Laserwellenlänge die Gitterkonstante d ermitteln. Das ist besonders interessant, wenn man als Gitter das Stück einer CD verwendet und bei bekannter Laserwellenlänge die Beugungswinkel misst. Dies geht sowohl in Reflexions- als auch in Transmissionsanordnung, wenn die Speicherfolie abgezogen wurde. Aus dem ermittelten Abstand der Strukturen lässt sich dann die Speicherdichte abschätzen. Entsprechend dem Babinetschen Theorem ist das Beugungsbild eines Einfachspalts bis auf die nullte Ordnung identisch mit dem eines Drahtes oder Haares, wenn Spaltbreite und Dicke identisch sind. Aus dem Beugungsbild eines Haares lässt sich also dessen Dicke dH leicht bestimmen, was den Lernenden stets viel Spaß bereitet. Beim Einfachspalt gilt N λ= (dH/2) sin α.
Prof. Dr Ilja Rückmann, Dr. Peter Schaller
Arbeitsblatt Wellenlängenbestimmung mit Beugungsgittern
Download unter Farbenspiele und Spektren
Optik Baukasten LASER-Optik-Kit „Snellius“
Mit diesem didaktisch neuen Versuchsaufbau werden optische Phänomene wie Reflexion, Brechung, Totalreflexion, Transmission, Dispersion, Beugung, Polarisation und optische Aktivität, die immer gemeinsam auftreten, durch das Konzept der didaktischen Reduktion einzeln untersucht. Das Laser-Optik-Kit „Snellius“, das aus den drei aufeinander aufbauenden Modulen Basic, Advanced und Komfort besteht, wird von Klassenstufe 7 an in Schulen bis zum Praktikum an Universitäten eingesetzt. Das Wesen des Versuches besteht darin, dass unter dem Koordinatensystem der transparenten Goniometerplatte, auf der ein Lasermodul auf einer Kreisbahn bewegt wird, neun verschiedenen Versuchs- und Protokollvorlagen angeordnet werden, mit denen die didaktische Reduktion auf den jeweiligen Versuchsinhalt erfolgt. Die Laser entsprechen der Laserklasse 2 und es stehen komfortable Schutzschirme zur Verfügung. Schutzrechte: Patent DE: 10 2006 015 436.3
Zu beziehen unter:
Snellius Lehrmittel-Zeulenroda, Prof-Scheibe-Str. 47, D-07937 Zeulenroda-Triebes
E-Mail: info@snellius lehrmittel.de
www.snellius-lehrmittel.de