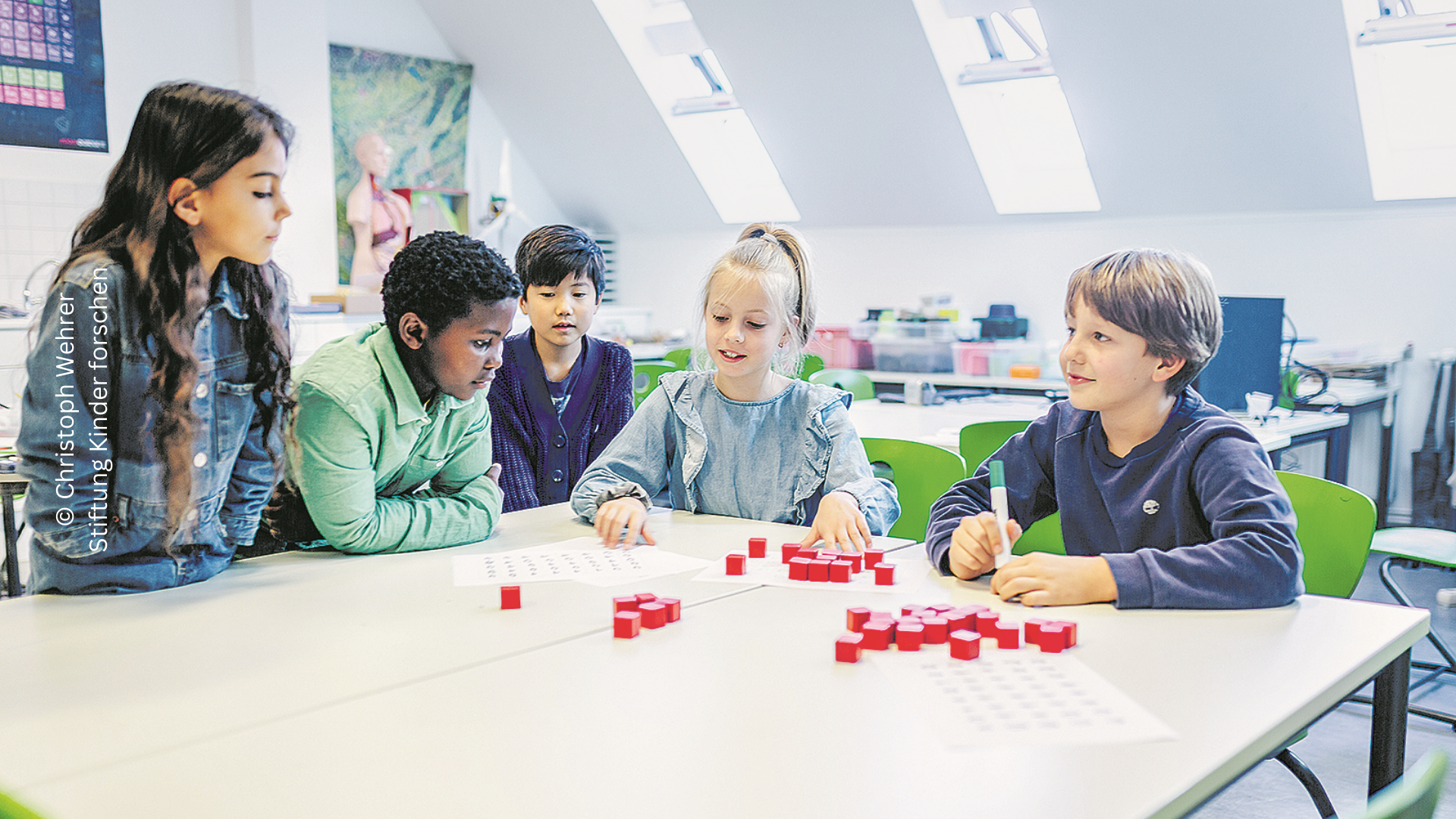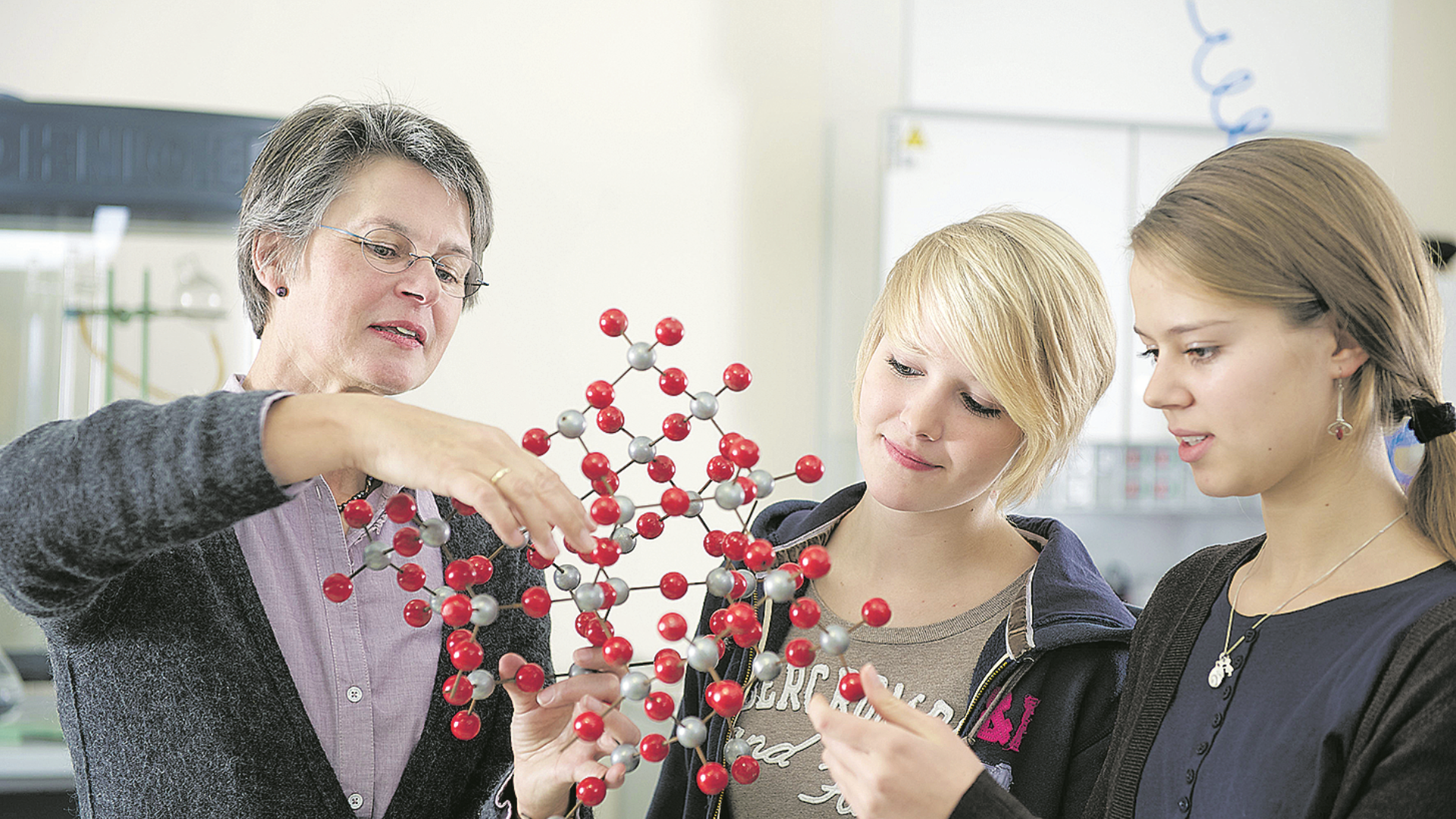Leonardo da Vinci gilt als das größte Universalgenie der Menschheit, weil er nicht nur für die Malerei unübertroffene Maßstäbe setzte, sondern zudem die modernen Wissenschaften anschob und als Erfinder seiner Zeit weit voraus war. Zumindest beim letzten Punkt sollte aber ein wenig Skepsis angesagt sein, wenn der vermeintliche Erfinder kein einziges Modell selbst gebaut oder in Auftrag gegeben hat.
In der Tat existieren keine Zeugnisse von Leonardos Erfindergeist – abgesehen von den Skizzen, in die er so viel seines zeichnerischen Talents hineingelegt hat, dass man als Betrachter seinen Hubschrauber in die Luft aufsteigen, seinen Panzer schießen und sein Schaufelradboot fahren sieht. Erliegt man diesem trügerischen Schein jedoch nicht, wird die Funktionsuntüchtigkeit der angeblichen Erfindungen Leonardos offenbar.
Das Prinzip des U-Bootes
So skizziert Leonardo zum Beispiel ein U-Boot im sogenannten Manuskript B. Das ovale Gebilde, das in der Mitte von einem Pfropfen verschlossen wird, kann beim besten Willen keinen Anspruch erheben, irgendetwas zum Verständnis der vielfältigen Probleme bei der Erkundung der Unterwasserwelt beizutragen. Es klingt grotesk, wenn Leonardo dem potenziellen Kommandanten des U-Boots den Rat erteilt: „Bevor du hineingehst und dich einschließt, tu hinaus die Luft und lass wieder Luft an Stelle des Vacuums hinein.“
Mit dem skizzierten Gerät in See zu stechen, wäre Selbstmord, denn ein durch zu hohes Gewicht oder undichte Stellen eingeleiteter Tauchvorgang wäre mangels probater technischer Mittel weder abzubrechen noch umzukehren. Der Pfropfen wäre aufgrund des Wasserdrucks schon bald von innen nicht mehr zu öffnen. Das Ersticken des todesmutigen Kapitäns möchte man sich nicht ausmalen.Es soll angemerkt werden, dass Leonardo erstaunlicher Weise aber bereits alles Wissen beisammen haben konnte, um tatsächlich ein U-Boot zu erfinden. Hätte sich der an vielen Tierarten Interessierte beim Studium von Fischen nicht nur die äußere Form, sondern auch deren innere Struktur so intensiv angeschaut, wie er es bei menschlichen Leichnamen getan hat, wäre ihm sicher die Schwimmblase aufgefallen. Die Funktion dieses Organs besteht darin, die Dichte des Organismus derjenigen des Wassers anzupassen, sodass Fische schweben können. Nun hätte Leonardo die evolutionäre Erfindung der Schwimmblasenur noch mit seiner Idee der doppelwandigen Schiffe zusammenbringen müssen, die er als Schutz gegen Zerstörungsversuche konzipiert hatte: Solange sich Luft im Raum zwischen den beiden Schiffswänden befindet, schwimmt das Boot. Sobald aber die Zwischenräume mit Wasser gef lutet werden, verringert sich der Auftrieb des Bootes und der Tauchgang könnte beginnen – vorausgesetzt, es würde sich um ein geschlossenes Boot handeln und das einf lutende Wasser würde hinreichend Abtrieb verursachen. Um wieder Auftrieb zu erzeugen, müsste das Wasser in den Hohlräumen wieder durch Luft ersetzt werden, wozu es eines recht hohen Druckes bedarf. Diesen Zusammenhang stellt Leonardo aber nicht her und so dauert es noch ein weiteres Jahrhundert, bis der deutsche Naturforscher Magnus Pegel (1547–1619) die theoretischen Grundlagen für das U-Boot findet.
Zahnradelemente zur Umkehr der Bewegung
Für die Fahrt auf dem Wasser entwirft Leonardo ein Schaufelradboot mit Pedalen. Um die Auf- und Abbewegung in die nötige horizontale Rotation für den Antrieb der Schaufeln zu übersetzten, nutzt er einen Riemen, der wiederum eine Walze in Bewegung setzt. Die Drehbewegung der Walze soll dann über ein sogenanntes Laternengetriebe auf ein Zahnrad übertragen werden, das wiederum in ein rechtwinklig dazu stehendes Zahnrad greift. Dieses treibt die Welle an, die mit den Schaufelrädern in Verbindung steht. Eine komplexe Maschinerie, die allerdings einige Fragen aufwirft. Wie leisten die Pedalen den Antrieb der Walze? Für die Verbindung von Antriebsriemen und Pedal gibt es augenscheinlich keine Idee. Ebenso wenig für den Mechanismus, der die Pedale bewegt. In der Skizze liegen sie wie zwei unbewegliche Bretter auf Deck und es ist kein Mechanismus zu sehen, mit dem sich die Pedale in den Riemen einhaken und wieder ausklinken könnten. Doch gibt es noch ein weiteres Problem: Wenn sich die Walze im Uhrzeigersinn bewegt und ihr Drehmoment auf die Zahnräder überträgt, dann bewegen sich beide Räder gegen den Uhrzeigersinn. Somit läuft das Ganze auf einen Getriebeschaden hinaus. Da die Zahnräder einander gegenüberliegen, versuchen sie nämlich die Stange, an der die Schaufeln befestigt sind, in die jeweils entgegengesetzte Richtung zu drehen, was zwangsläufig zu einem Crash führen muss. Die Schaufelräder selbst waren ebenfalls keine Erfindung Leonardos. Schon der römische Architekt Marcus Vitruvius Pollio, genannt Vitruv, beschreibt ein Schaufelrad ausführlich in seinen Aufzeichnungen. Leonardos Schaufelradboot ist nicht mehr als die hingeworfene Skizze eines hellwachen Geistes und vielseitig interessierten genialen Malers. Dafür sprechen auch die Notizen, die er auf das Blatt kritzelt. Es handelt sich dabei um lateinische Vokabeln, die Leonardo besonders in seiner ersten Mailänder Zeit paukt. Seine Skizze des Schaufelradboots steht für ihn im Rang möglicherweise nicht höher als das stupide Erlernen einer anderen Sprache, auch wenn der Geniekult um ihn so viel mehr daraus machen möchte.
Der senkrechte Start in die Luft mit dem Bernoulli-Prinzip
Beim Entwurf seiner Flugschraube gibt Leonardo eine beeindruckende Kostprobe seines zeichnerischen Könnens. Mit Feder und Tusche malt er eine sich in zwei Windungen nach oben verjüngende Vorrichtung. In der Mitte steht ein Pfahl, der offensichtlich am Boden des Flugapparats drehbar gelagert ist. Wie dieses Gerät in die Luft aufsteigen soll, verrät Leonardo allerdings nicht und lässt damit die beiden Hauptprobleme des senkrechten Starts in die Luft unbehandelt. Zuerst stellt sich die Frage des Antriebs. Mit etwas Fantasie wird man am unteren Ende des mittigen Mastes eine horizontal durch das Holz laufende Stange erkennen. Damit könnte das Gerät von mehreren Männern angeschoben werden, wenn diese nach dem Prinzip der Ochsenmühle im Kreis laufen. Allerdings würde sich der Effekt in der Luft selbst aufheben, weil die Männer dann gewissermaßen im Leerlaufmodus treten würden. Aber könnte sich diese Konstruktion überhaupt in die Luft schrauben? Im Medium Holz kann eine Schraube in jeder beliebigen Richtung vordringen. Bei Wasser liegt der Fall nicht anders. Schon Archimedes erfindet Pumpen, die Wasser befördern, indem sie sich in das Element hineindrehen. Doch in der Luft kann das Prinzip aufgrund der – im Vergleich zum Wasser – 800-fach geringeren Dichte nicht funktionieren.
Hier braucht es das Bernoulli-Prinzip: Ein Rotor teilt aufgrund seiner gewölbten Oberf läche die Luft in eine langsamer strömende untere und eine schnellere obere Schicht. Diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten zeichnen für einen höheren Druck unter dem Rotorblatt und einen niedrigeren darüber verantwortlich. So wird der senkrechte Start in die Luft möglich – wenn genügend Antriebsenergie verfügbar ist.
Antriebsprobleme beim Panzer
Um 1485 skizziert Leonardo einen Panzerwagen, der mit so hoher Geschwindigkeit auf dem Schlachtfeld unterwegs ist, dass er Staubwolken aufwirbelt. Am unteren Rand der Zeichnung sieht man in gleichmäßigen Abständen die Mündungen dünner Kanonenrohre, die den Panzer in alle Richtungen schussbereit machen sollen. Offensichtlich plant Leonardo den Antrieb über zwei sich gegenüberliegende Kurbelwellen, die von Hand bedient werden sollen. Bei synchroner Kurbelbewegung könnte sich das Gefährt im Idealfall geradeaus fortbewegen. Durch die zu erwartenden Unebenheiten des Schlachtfeldes allerdings ist eher eine Fahrt in Schlangenlinien zu befürchten. Für die praktische Anwendung erweist sich sein Entwurf eines Panzers als vollkommen unbrauchbar.
Erbe des italienischen Faschismus
Leonardo war kein Universalgenie, sondern ein Universalneugieriger. Er studierte vieles und übertrug die Gerätschaften, die er für bedenkenswert hielt, in seine Notizbücher. Diese Zeichnungen krönte er mit der gerade erfundenen perspektivischen Darstellung, die er meisterlich beherrschte. Ideen, die ihm beim Kopieren von Entwürfen anderer kommen, fügt er in seine Skizzen ein. Die zugehörigen Kommentare adressiert er in Du-Form an sich selbst, eine Veröffentlichung seiner Notizbücher erwägt er offensichtlich nicht. Erst im 20. Jahrhundert entsteht die Idee, aus Leonardo den Erfinder zu machen, der er selbst niemals zu sein behauptete. Vor allem Benito Mussolini (1883–1945) will in Leonardo mehr als nur einen genialen Maler sehen. Eine erste Ausstellung, die auch Modelle der angeblichen Erfindungen des nach dem Duce nunmehr zweitgrößten Sohnes Italiens vorstellt, startet 1939 in Mailand und wandert von dort aus um die Welt. Nach dem Ende der faschistischen Diktatur in Italien werden die Legenden um Leonardo erstaunlich hartnäckig weitergeführt. Merkwürdig kritiklos übernehmen Publizisten, Ausstellungsmacher und selbst Wissenschaftler bis heute die Mär vom Erfinder Leonardo. Im Zeitalter des forcierten Spezialistentums kommen Geschichten von einem Universalgenie aus längst vergangener Zeit offenbar gut an.
Weiterführende Informationen
Literatur: Matthias Eckoldt (2019). Leonardos Erbe. Die Erfindungen da Vincis – und was aus ihnen wurde. München: Penguin Verlag