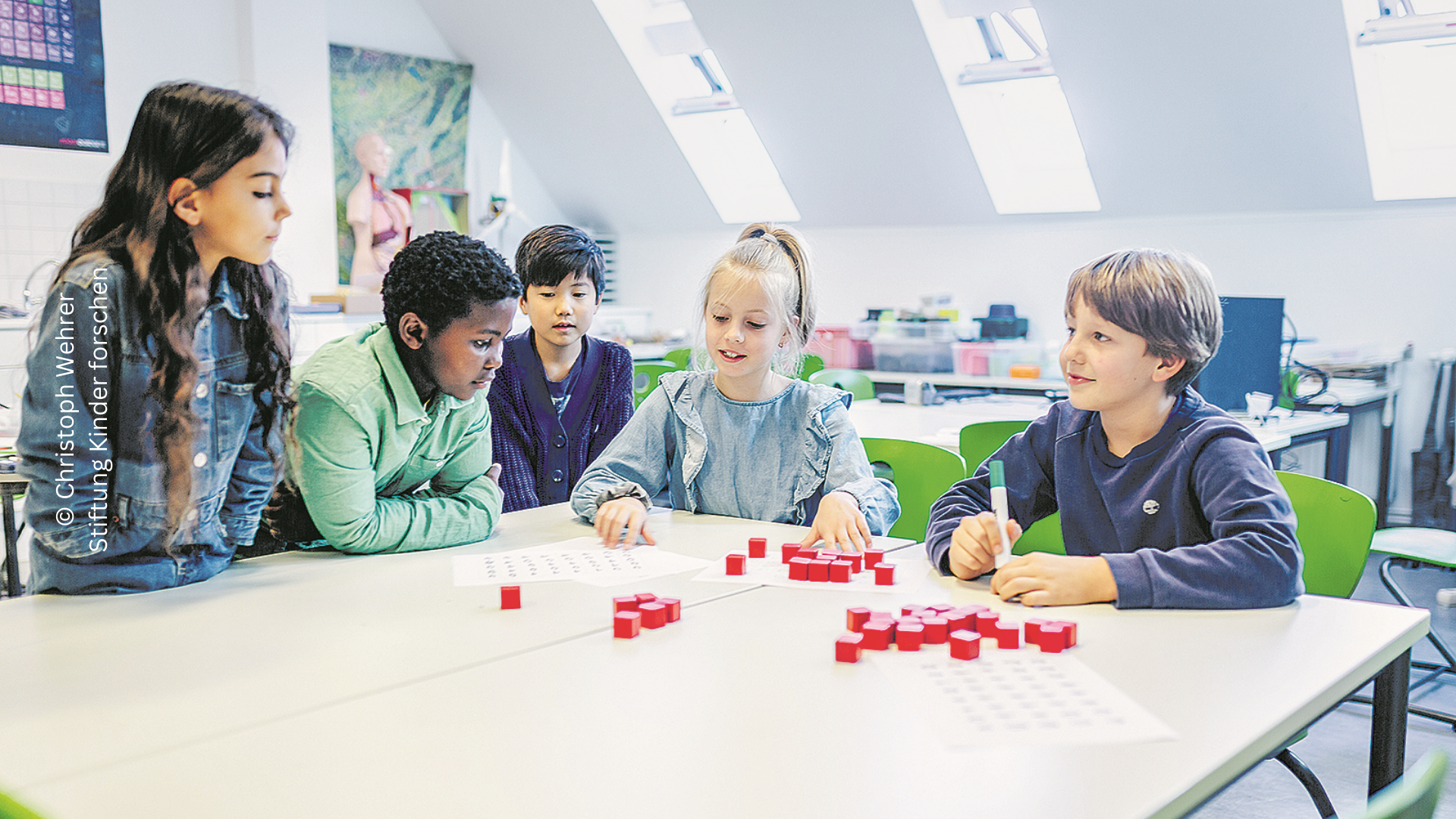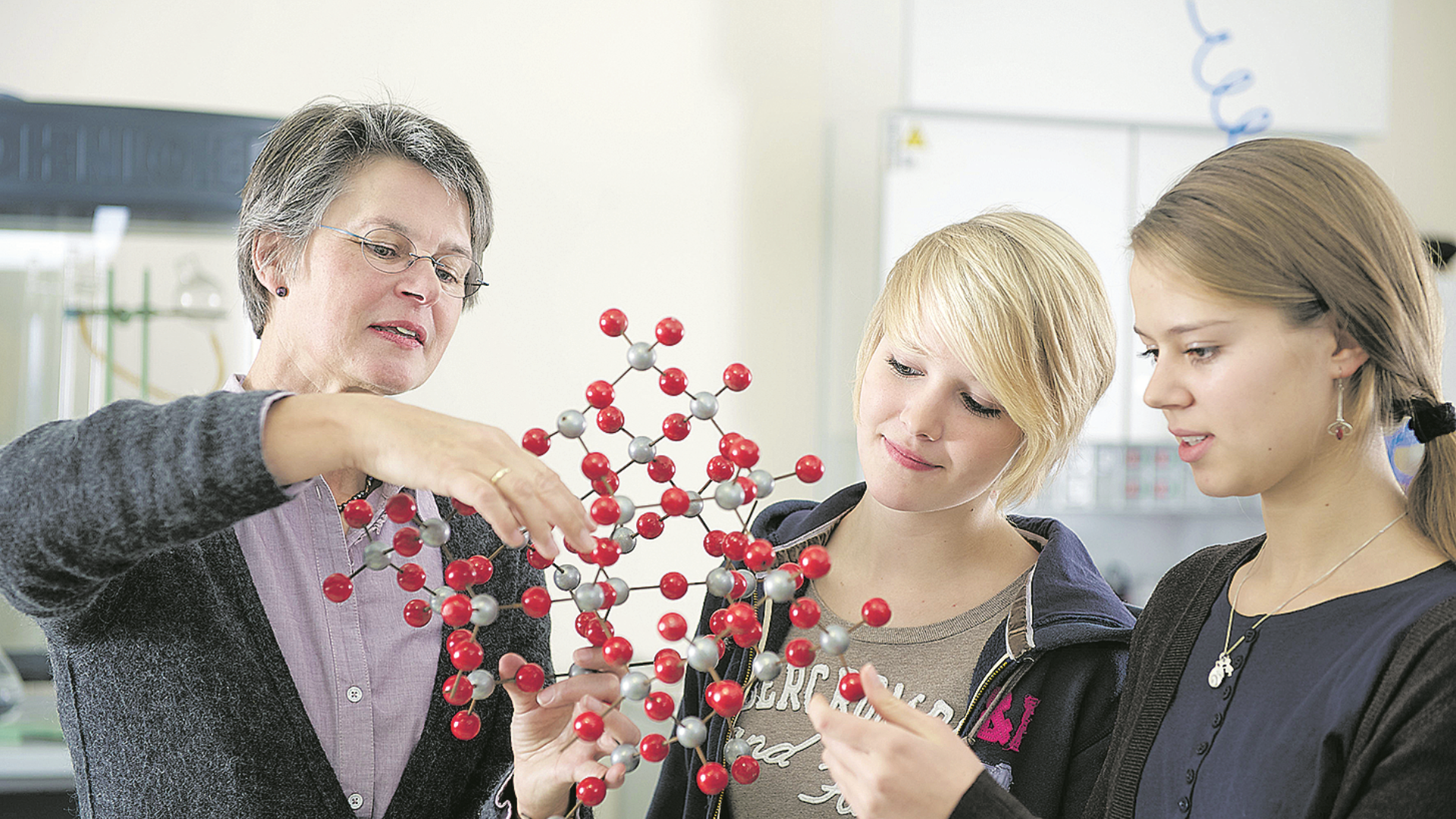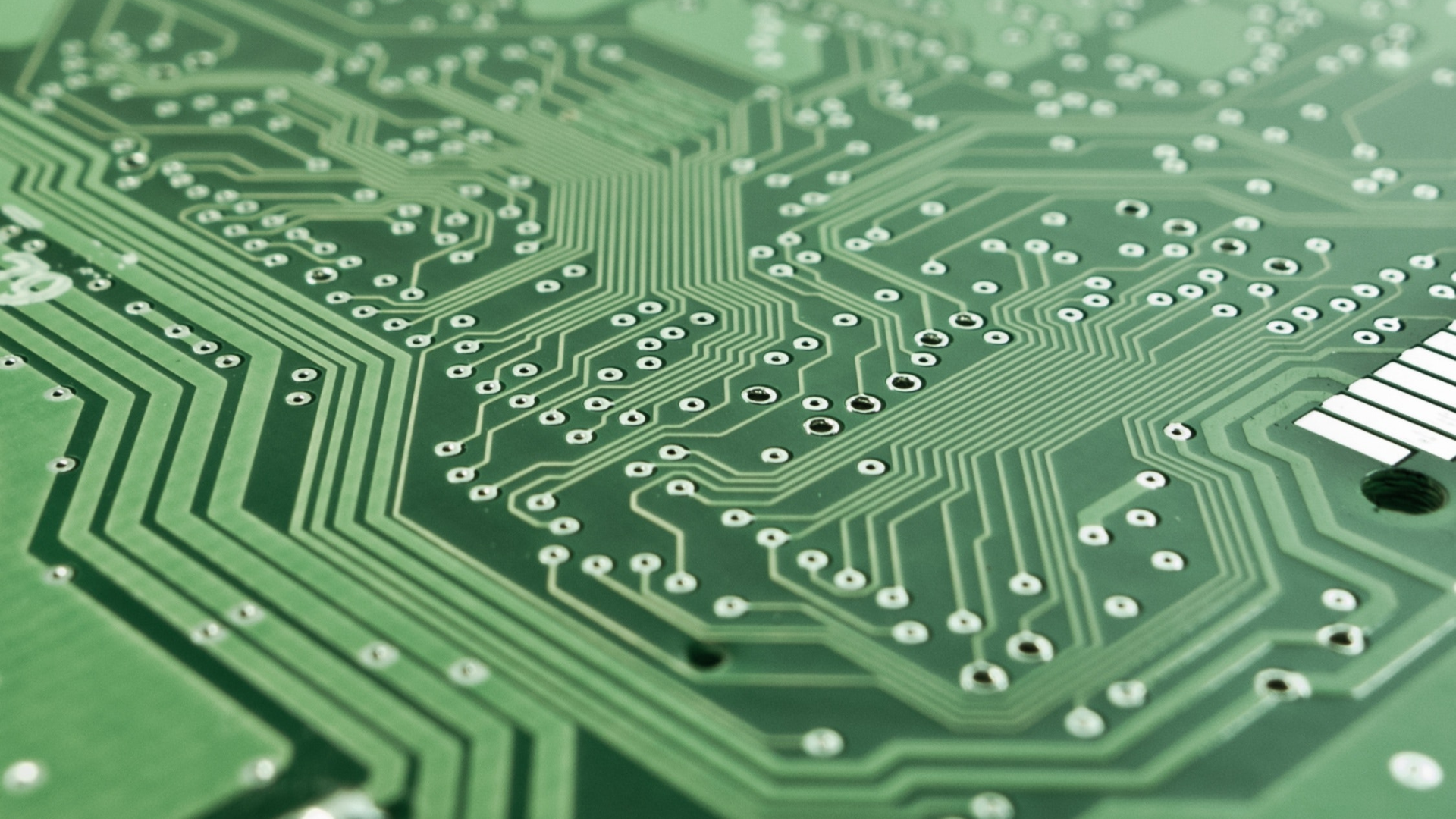Die Zeit ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Die Relativitätstheorie hat die Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft revolutioniert – und macht Physikern und Philosophen immer noch Probleme.
Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“, schrieb Hugo von Hofmannsthal im Libretto für die Oper Der Rosenkavalier. Das gilt bereits für die Physik – und erst recht, wenn man die Zeit als Dimension unseres Erlebens auch im Rahmen von Hirnforschung, Psychologie oder Kunst betrachtet. Zwar besteht das Erfolgsgeheimnis einer Wissenschaft darin, bestimmte Fragen nicht zu stellen. Doch bleiben noch genug Schwierigkeiten übrig – und manche Fragen kommen gleichsam durch die Hintertür zurück. Es gibt kaum ein drastischeres Beispiel dafür als den Zeit-Begriff. Er ist verwirrend und vieldeutig, aber seine Facetten sind nicht zusammenhanglos. So meint „Zeit“ …
- das Aufeinanderfolgen von Ereignissen,
- das Intervall in dieser Abfolge,
- die Dauer,
- einen bestimmten Augenblick,
- eine Variable, die die Dauer misst.
Temporale Fragwürdigkeiten
Schon in der Antike haben Philosophen versucht, der Natur der Zeit auf die Spur zu kommen. Aber die Definitionen waren zirkulär, weil sie bereits temporale Begriffe enthielten. Deutlich wurde jedoch, dass Bewegung, Veränderung, Kausalität und sogar Bewusstsein auf eine ziemlich undurchsichtige Weise miteinander verschränkt sind. Auch heute herrscht noch keine Einigkeit über den Status von Zeit und Raum: Sind sie …
- eigenständige Gegenstände (oder metaphysische Substanzen)?
- (physikalische) Eigenschaften von Gegenständen?
- Beziehungen (Relationen) zwischen Gegenständen?
- Sachverhalte?
- Vorstellungen a priori beziehungsweise (angeborene) Anschauungs- oder Denkformen des menschlichen Geistes, und damit Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt, nicht aber etwas Objektives im subjektunabhängigen Reich der „Dinge an sich“?
- Konstrukte des Gehirns, des Bewusstseins oder der Grammatik der Sprache, denen keine selbstständige Existenz zukommt?
Relational oder absolut?
Diese Fragen münden letztlich in eine Kontroverse, die seit Langem in der Physik und Philosophie besteht und trotz vieler Fortschritte – die Relativitätstheorie eingeschlossen – nicht gelöst ist. Vereinfacht stehen sich zwei Auffassungen gegenüber: Dem Relationismus zufolge, für den etwa Aristoteles, Gottfried Wilhelm Leibniz und Ernst Mach argumentiert haben, existiert Zeit nur, wenn es Veränderungen und somit Beziehungen zwischen Dingen gibt. Im Extremfall ist Zeit dann ein abgeleitetes Produkt oder eine Illusion. Dem Absolutismus zufolge, favorisiert beispielsweise von Platon oder Isaac Newton, kann Zeit auch ohne eine Veränderung von Dingen und Beziehungen vergehen. Demnach wäre es möglich, dass das ganze Universum erstarrt und trotzdem eine „leere“ Zeit verstreicht – vielleicht Milliarden Jahre zwischen dem Lesen dieses Satzes und des nächsten. Zeit wäre dann fundamental und nicht auf etwas anderes zurückführbar.
Die relationale Konzeption der Zeit hat bereits Aristoteles in seiner Schrift Physik klar charakterisiert: Zeit als „die Zahl der Veränderung betreffs des Früheren und des Späteren“, also als Maß der Veränderung. Im Bewusstsein sei das Vergehen der Zeit ebenfalls zu erleben, selbst wenn sich äußerlich nichts wandelt. Newton widersprach dieser Ansicht nicht. Er wollte sie aber von einer anderen unterschieden wissen, die er als Voraussetzung für seine Formulierung der Mechanik und Dynamik benötigte. In seinem epochalen Werk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) schrieb er: „Zeit […] als allen bekannt, erkläre ich nicht. Ich bemerke nur, dass man gewöhnlich diese Größen nicht anders als in Bezug auf die Sinne auffasst und so gewisse Vorurteile entstehen, zu deren Aufhebung man sie passend in absolute und relative, wahre und scheinbare, mathematische und gewöhnliche unterscheidet.“ Und weiter: „Die absolute, wahre und mathematische Zeit fließt auf Grund ihre eigenen Natur und aus sich selbst heraus ohne Beziehung zu etwas Äußerem gleichmäßig dahin.“
Physikalische Variable und Uhren-Vielfalt
In der Physik ist die Zeit t spätestens seit Galileo Galilei eine Variable in Gleichungen wie h = gt2/2 und v = g . t (h ist im Fallgesetz die Höhe, g die Fall- oder Schwerebeschleunigung, v die Fallgeschwindigkeit). Dies war ein erfolgreicher pragmatischer Ansatz, der Zeit nicht definiert, sondern operationalisiert. Albert Einstein hat dies später – nicht nur scherzhaft – so ausgedrückt: „Zeit ist das, was die Uhr anzeigt.“ Die Zeitmessung basiert freilich auf dem Postulat der Gleichförmigkeit eines Naturgeschehens und hat damit eine naturgesetzliche Grundlage, etwa die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit oder die Regelmäßigkeit von atomaren Prozessen. In Betracht kommt eine Vielzahl von als „Uhren“ verwendbarer Naturvorgänge, deren Tauglichkeit und somit Genauigkeit abhängt von Störungen durch äußere Faktoren. Beispielsweise ist die Erdrotation inzwischen für moderne Erfordernisse viel zu unregelmäßig. Dass die verschiedenen Zeitmessungen zusammenpassen und vergleichbar sind, ist keineswegs trivial. Aber bislang hat sich das Ideal der Einheit der Zeit als regulatives Prinzip bewährt und zeigt die Kohärenz des physikalischen Wissens.
Allerdings kann ein Instrumentalismus, der den Begriff der Zeit auf Zeitbestimmungen einschränkt, als unzureichend kritisiert werden. Richard Feynman prägte das Bonmot: „Zeit ist, was passiert, wenn sonst nichts passiert.“ Das ist freilich wiederum zirkulär oder ein Rückfall in die Konzeption der absoluten Zeit.

Revolutionäre Relativitätstheorie
Laut Newton vergeht Zeit ohne Beziehung zu etwas Äußerem. Die Zeit ist quasi ein Substratum, in dem physikalische Ereignisse situiert sind. Das bedeutet: Man kann sich überall im Universum eine imaginäre Uhr denken, und alle diese Uhren zeigen stets dieselbe Zeit an. Simultanität und Zeitspannen sind dann unabhängig vom Bezugssystem der Beobachter.
Diese Hypothese einer absoluten Zeit jedoch wurde von der Speziellen Relativitätstheorie widerlegt: Uhren mit hoher Geschwindigkeit gehen langsamer (Zeitdilatation). Würde ein Raumfahrer z. B. mit dem Beschleunigungs- und Bremsandruck von 1 G (entspricht der Erdschwerkraft) mit bis zu 99,9992 Prozent der Lichtgeschwindigkeit zu einem 500 Lichtjahre entfernten Stern fliegen und wieder zurück, wäre er aufgrund der relativistischen Zeitdehnung nur um knapp 25 Jahre gealtert, während auf der Erde 1.000 Jahre vergangen wären. Für lichtschnelle Photonen verrinnt überhaupt keine Zeit. Einsteins Konzeption der relativen Zeit zufolge hängt die Zeitmetrik also vom Bezugssystem ab. Objektiv sind nur raumzeitliche Abstände. Es gibt gleichberechtigte Eigenzeiten, aber keine universelle Gleichzeitigkeit. Die Zeit verschmilzt als vierte Dimension mit den drei Raum- Dimen sionen zur Raumzeit.
In Newtons Mechanik ist die Metrik der Zeit intrinsisch. Diese Auffassung hat die Allgemeine Relativitätstheorie widerlegt. Ihr zufolge kovariiert die Raumzeit- Metrik mit Masse und Energie: Raum und Zeit sind nicht voneinander getrennt, sondern in einem vierdimensionalen Raumzeit- Kontinuum miteinander verknüpft, das wiederum von Masse und Energie beeinflusst wird. Daher gehen Uhren in einem Gravitationsfeld langsamer; am Rand eines Schwarzen Lochs bleibt die Zeit gleichsam stehen – aus der Ferne betrachtet.
Die Raumzeit kann sogar eine innere Dynamik haben und ist insofern physikalisch real. Beispielsweise existieren Lösungen von Einsteins Feldgleichungen, die expandierende Universen frei von Materie und Strahlung beschreiben. Allerdings gibt es auch Weltmodelle mit einer kosmischen Zeit, wobei die Ausdehnung des Weltraums als globales Zeitmaß dienen kann. Tatsächlich leben wir in einem solchen Universum, das vor 13,8 Milliarden Jahre aus einem Urknall entstanden ist. Es bleibt jedoch rätselhaft, warum die Zeit eine Richtung hat („Zeitpfeil“) und ob der Urknall als „Moment ohne Vergangenheit“ der Beginn der Zeit überhaupt war oder lediglich ein Übergang.
Ein Ticken von Zeit-Atomen?
Ob eine fundamentale Längen- und Zeitskala existiert ist unklar, aufgrund der Quantentheorie aber plausibel. Die Raumzeit wäre demnach quantisiert wie die Energie, die nur „portionsweise“ übertragen werden kann. Dann gäbe es eine kürzeste Zeitspanne, die Zeit würde somit „ruckartig“ vergehen. Diese kleinste Zeit- Einheit heißt Planck-Zeit. Max Planck hat sie bereits 1899 definiert als Kombination der drei fundamentalen Naturkonstanten ħ (reduzierte Planck-Konstante), G (Gravitationskonstante) und c (Lichtgeschwindigkeit): tPl = √ħG/c5 = 5,4 . 10-44 Sekunden. Eine Theorie der Quantengravitation, die die Schwerkraft quantisiert und von Raumzeit-„Atomen“ handelt, steht noch aus. Doch viele Physiker folgen der Überzeugung von John Wheeler: „Zeit als solche kann nicht das letzte Konzept bei der Beschreibung der Natur sein. Zeit ist weder ursprünglich noch genau. Sie ist eine Schätzung. Sie ist ein sekundärer Begriff. Sie wird in ihrer Wichtigkeit irgendwann ins zweite Glied rücken.“
Rüdiger Vaas
Über den Autor:
Rüdiger Vaas ist Philosoph, Publizist, Dozent sowie Astronomie- und Physik-Redakteur beim Monatsmagazin bild der wissenschaft. Neben zahlreichen wissenschaftsjournalistischen Arbeiten veröffentlichte er auch philosophische Fachartikel über Kosmologie, Wissenschaftstheorie, Anthropologie und Hirnforschung. Er ist Mitherausgeber des Fachbuchs The Arrows of Time (Springer) sowie Autor von 14 Büchern.
Literaturtipps zum Thema von Rüdiger Vaas (alle KOSMOS Verlag, Stuttgart):
- Tunnel durch Raum und Zeit. Schwarze Löcher, Zeitreisen und Überlichtgeschwindigkeit. (2018, 8. Aufl.)
- Jenseits von Einsteins Universum. Von der Relativitätstheorie zur Quantengravitation. (2017, 4. Aufl.)
- Hawkings neues Universum. Wie es zum Urknall kam. (2018, 6. Aufl.)